Inhalt
2.1 Mobile Technologien und Risikolerner in der Medienpädagogik – Überblick über Hauptakteure und thematische Schwerpunkte
2.1.1 Mobile Technologien, insbesondere das Handy, in der deutschen Medienpädagogik
Das Thema Mobile Technologien, insbesondere das Handy, ist seit etwa 2005 Teil der Diskussion innerhalb der deutschen Medienpädagogik. Die jährlichen Studien zu Jugend-Information-Medien (JIM-Studien) des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest (mpfs) berichteten in der Publikationsreihe, dass in 2003 nur 86 % der Jugendlichen ein Handy hatten (Feierabend & Klingler, 2004a, S. 51), in 2004 und 2005 hatten bereits 90 % bis 92 % ein Handy (2004b, S. 53; 2005, S. 48).
Eine der ersten umfangreichen Veröffentlichungen zum Thema Jugendliche und Handy war das Heft „Handys im Jugendalltag“ der Zeitschrift „merz – medien+erziehung“ (Heft 3, 2005), herausgegeben vom JFF, dem Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. Das Heft widmet sich der Frage, was Jugendliche mit Handys machen, wie Handys in den Alltag Jugendlicher und in den familiären Alltag eingebunden sind, wie Jugendliche zum Handy stehen und zur besonderen Sprache der Kurzmitteilungen (SMS). Behandelt werden ebenfalls Aspekte zum Jugendschutz sowie wirtschaftlichen Perspektiven zum Handy. Das Heft entstand zu einer Zeit, als sich herauskristallisierte, dass Kinder meist beim Übergang in die fünfte Klasse, am Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe 1, von ihren Eltern ein Handy geschenkt bekommen, um wegen der meist größeren räumlichen Distanz zur neuen Schule erreichbar zu sein (Ehler, 2005a, S. 10). Gleichzeitig war zu beobachten, dass nun auch einige Grundschüler Handys hatten (ebenda). Karin Ehler stellt in diesem Heft das Handy vor allem als Schuldenfalle heraus und erklärt in diesem Bereich den pädagogischen Handlungsbedarf (Ehler, 2005b, S. 36).
Das Institut für Medienpädagogik JFF in München und der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest (mpfs) in Baden-Baden veranstalteten im Jahr 2006 verschiedene Informationsveranstaltungen und Fachforen, um einen genaueren Blick auf das Verhältnis von Kindern und Jugendlichen zum Handy zu werfen und über die Risiken, die im Handygebrauch stecken, zu informieren (Demmler, 2006). Das Info-Set des mpfs wurde durch ein neues Beratungsangebot für Eltern zum Thema Handy, das Themenheft „Handy & Co.“, erweitert und Claus J. Tully präsentierte sein Positionspapier auf der Pressekonferenz am 16. Mai 2006 zur Fachtagung „Handys im Alltag von Kindern und Jugendlichen“ (Tully, 2006). Im Rahmen dieser Pressekonferenz machten Wolfgang Mack und Ulrike Wagner vom JFF darauf aufmerksam, dass den Jungen bei dieser Betrachtung besondere Aufmerksamkeit zukommen sollte (Mack, 2005; Wagner & Kirchhoff, 2005). Zentral ist dabei, dass das Handy in Lage ist, Dateien zu speichern, sie wiederzugeben und sich mit anderen Handys und dem Internet zu verbinden. Die Gefahr, in finanzielle Notlage zu geraten, entsteht beim Download von Klingeltönen, Musik und Spielen sowie beim Telefonieren, beim Senden von SMS und beim Senden von Videos und Bildern. Mit der Möglichkeit, Videos mit dem Handy selbst aufzunehmen, zu tauschen und zu speichern, konnte man beobachten, wie Inhalte auf den Handys der Schüler auftauchten, die pornografische Darstellungen und Gewaltdarstellungen enthielten und somit jugendschutzrelevant sind (Demmler & Wagner, 2006; Rathgeb, 2006). Diesen Stand fassten dann die beiden Bücher „Handy – Eine Herausforderung für die Pädagogik“ (Anfang, Demmler, Ertelt, & Schmidt, 2006; Demmler & Wagner, 2006) und „Slapping, Bullying, Snuffing”‘ (Grimm & Rhein, 2007) – mit besonderem Bezug zu Gewaltvideos auf Handys – zusammen.
Die Medienpädagogik steckte also in Bezug auf Kinder und Jugendliche und deren Handynutzung im Wesentlichen folgende drei Problemfelder ab:
-
Kinder und Jugendliche können sich durch das Telefonieren, das Schreiben von SMS und den Download von Klingeltönen und MMS finanziell verschulden.
-
Handys, die Videos aufnehmen und abspielen können bzw. diese durch verschiedene Netzwerkfunktionen verbreiten können, stellen ein Novum dar, das Erwachsene vor eine gewisse Ratlosigkeit stellt und einen Beratungsbedarf erzeugt.
-
Kinder und Jugendliche können an Gewaltvideos herankommen, diese verbreiten und selbst produzieren. Hierbei stehen hauptsächlich Jungen im Verdacht, eine besondere Affinität zu Gewaltvideos zu haben und damit besonders gefährdet zu sein.
2.1.2 Risikolerner in der deutschen Medienpädagogik
In den letzten 10 Jahren haben sich in der deutschen Medienpädagogik im Wesentlichen drei zentrale Figuren unmittelbar und auf breiter Ebene mit jugendlichen Risikogruppen beschäftigt und diese im Kontext des hier eingeführten Begriffes der Risikolerner eingeordnet. Das sind Prof. Dr. Horst Niesyto von der Abteilung Medienpädagogik der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, Prof. Dr. Nadia Kutscher vom Fachbereich Sozialwesen an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen in Aachen und Ulrike Wagner vom JFF, Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis in München.
Aus der Schweiz ist zudem Prof. Dr. Heinz Moser von der Abteilung Unterrichtsprozesse und Medienpädagogik der Pädagogischen Hochschule Zürich von hoher Relevanz. Er beschäftigt sich im Bereich der Medienpädagogik mit Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Aus Österreich ist Prof. Dr. Ingrid Paus-Hasebrink vom Institut für Kommunikationswissenschaft an der Universität Salzburg zu nennen, die sich mit der Mediensozialisation sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher in Österreich beschäftigt.
Mit der Studie „Medienpädagogik und soziokulturelle Unterschiede“, gefördert durch den Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest (mpfs), legte Horst Niesyto (2000) vor etwa 10 Jahren eine Expertenbefragung in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz vor mit dem Ziel, „bisherige Erfahrungen von medienpädagogischen Angeboten und Projekten mit Kindern und Jugendlichen aus benachteiligten Verhältnissen zu erheben und auszuwerten und für eine konzeptionelle Weiterentwicklung fruchtbar zu machen“ (Niesyto, 2000, S. 6). Mit Verweis auf Studien zur Lesesozialisation, zur Fernsehnutzung und zur Internetnutzung stellt Niesyto heraus, dass die Medienwelten der Kinder und Jugendlichen aus sozialen und bildungsmäßigen Problemlagen und speziell der Jugendlichen an der Hauptschule besonderer medienpädagogischer Aufmerksamkeit bedürfen (ebenda).
Nadia Kutscher u. a. legten in 2009 die durch die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) geförderte Studie „Medienkompetenzförderung für Kinder und Jugendliche in benachteiligten Lebenslagen“ vor (Kutscher, Klein, Lojewski, & Schäfer, 2009). Die Studie hat die aktive Medienarbeit mit sozial benachteiligten Jugendlichen und die Qualifizierung von pädagogischem Personal hinsichtlich der Medienkompetenz der Jugendlichen im Blick. Die Zielgruppe „benachteiligte Kinder und Jugendliche“ entwickeln die Autoren aus der Wissenskluft-Hypothese (Digital Divide), die darauf verweist, „dass sich Bildungsungleichheiten […] über die Mediennutzung (im Hinblick auf mediale Präferenzen und Nutzungsweisen) in Form von medial bedingten Wissensklüften fortsetzen“ (ebenda, S. 17). In der Studie bedeutet dies die Konzentration auf die Schüler der Hauptschule.
Auch die Studie von Ulrike Wagner vom JFF mit dem Titel „Medienhandeln in Hauptschulmilieus“ untersucht zentral die Mediennutzung von Hauptschülerinnen und Hauptschülern. Diese Gruppe Heranwachsender bildet den Kern der Risikogruppe der Bildungsbenachteiligten. Eine systematische Untersuchung der Mediennutzung dieser Risikogruppe „erweitert den Blick auf Kompetenzbereiche dieser Heranwachsenden, die sich der schulischen Leistungsbeurteilung entziehen, und sie fokussiert auf die Fähigkeiten und Handlungsroutinen, die diese Heranwachsenden im Umgang mit diesen Medien entwickeln und damit auf die Ausgangsbedingungen, die die Heranwachsenden für Bildungsprozesse mitbringen“ (Wagner, 2008, S. 21).
Die Ergebnisse dieser Studien werden in Kapitel Fehler: Referenz nicht gefunden präsentiert. Für die Frage nach Risikolernern und deren Mustern der Nutzung mobiler Technologien bleibt festzuhalten, dass es bislang die Gruppe der Hauptschüler ist, die von sozialer und bildungsmäßiger Benachteiligung betroffen ist und derer sich die Medienpädagogik systematisch gewidmet hat.
Neben diesen unmittelbaren Zugängen der Medienpädagogik zu jugendlichen Risikogruppen und Gruppen mit expliziter sozialer Benachteiligung ordnet Ben Bachmair (2002; 2003) exemplarisch die Schul- und Lesekarriere des 11-jährigen türkischen Jungen Erkan in das theoretische Dreieck aus sozialen Strukturen, Handlungskompetenz und kultureller Praxis ein und legt in seinem zweiteiligen Beitrag unter der Überschrift „Kulturelle Ressourcen“ konzeptionell den Grundstein für die von der London Mobile Learning Group (LMLG) ab 2006 / 2007 sogenannte Sozio-kulturelle Ökologie des Mobilen Lernens (siehe Kapitel Fehler: Referenz nicht gefunden).
Der 11-jährige türkische Junge Erkan lebt in Deutschland und besucht die Grundschule. Erkans Lesekarriere ist erwartungsgemäß weit entfernt von den Anforderungen, die Schule üblicherweise stellt. Dennoch gelingt es Erkan, außerhalb der Schule im intimen Dialog mit dem Vater die komplexen Ergebnislisten der Formel-1-Übertragung im Fernsehen zu verbalisieren und für sich und seinen Vater sinnvoll zu versprachlichen. Bachmair geht es dabei um die Lesekompetenz im Sinne der PISA-Studien, die Kinder und Jugendliche im Alltagsleben erwerben, indem sie sich reflexiv mit diskontinuierlichen Textsorten wie Ergebnislisten einer Formel-1-Übertragung beschäftigten, woraus Chancen für Medienbildung entstehen.
Das Thema dieser beiden Texte liegt nicht im zentralen Fokus dieser Arbeit. Bedeutsam sind sie aber, wenn es darum geht, Erkan als jugendlichen Jungen mit Migrationshintergrund analytisch und als prototypischen Vertreter für eine der Kerngruppen der Risikolerner zu erfassen und zu beschreiben. Die wesentliche Bedeutung liegt aber auch in der praktisch-analytischen Anwendung der Sozio-kulturellen Ökologie auf Erkans Alltagsleben und auf seine Mediennutzungsmuster. Dabei ordnet Ben Bachmair den Grundschüler Erkan anhand der PISA-Studien in die entsprechende sozialstrukturelle Lage innerhalb der Gesellschaft ein und zeigt die Verbindung zwischen der alltäglichen Mediennutzung und der damit zusammenhängenden und entstehenden Lesekompetenz als Handlungskompetenz auf. Dabei wird deutlich, dass Erkan an dieser Stelle im Alltagsleben etwas gelingt, das es gilt, im schulischen Alltag aufzugreifen, zu fördern und im Idealfall zu zertifizieren.
Es werden weitere Studien und Projekte, die das theoretische Dreieck der Sozio-kulturellen Ökologie als Grundlage verwenden, nötig sein, um dessen Anbindung und Verbindungslinien zu verdeutlichen und um letztlich die Bedeutung der aktuellen Transformation der Medienlandschaft und der Massenkommunikation, die mit dem mobilen Lernen einhergeht, zu beschreiben.
2.2 Lerner in riskanten Gemengelagen – Erste Annahmen und Zugänge zu Risikolernern
Im April 2001 veröffentlichte das deutsche PISA-Konsortium die Ergebnisse der internationalen Schulleistungsstudie der OECD in Bezug auf 15-jährige Schüler in Deutschland (Deutsches PISA-Konsortium, 2001a). Das Ergebnis war besorgniserregend bis schockierend: 20 % bis 25 % der 15-jährigen Jugendlichen erreichen nicht die basalen Anforderungen in der Lesekompetenz. Als zentrale Risikogruppe, also diejenigen Schüler, die nicht die erforderlichen Leistungen im PISA-Leistungstest erbringen konnten, identifizierte die Studie besonders Jungen, insbesondere mit Migrationshintergrund, sowie allgemein Hauptschüler. Somit hat die PISA-Studie eine recht greifbare und eindeutige Gruppe von Schülern identifiziert, die auch für diese Arbeit hohe Relevanz hat.
Im Zentrum dieser Arbeit steht die Alltags- und Lebensbewältigung jugendlicher Jungen und die Frage nach den Medienbildungschancen, die in den Nutzungsmustern mobiler Technologien stecken. Eine der leitenden Fragen dabei ist, wie Jungen in riskanten Kulturen das Handy nutzen, um ihren Alltag und ihre Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Was gelingt ihnen dabei und wobei brauchen sie medienpädagogische Unterstützung und Förderung? Letztlich und im Idealfall sollte den Risikolernern die Handynutzung im Alltag etwas nützen, um mit einer Grundqualifikation wie z. B. dem qualifizierten Hauptschulabschluss die Pflichtschuljahre zu beenden. Im Mittelpunkt der Arbeit sind Jungen im Jugendalter, die in der Lesekompetenz der PISA-Studie 2000 am schlechtesten abschnitten, von Medienverwahrlosung bedroht sind, sich selbst riskant gefährden und prekären Arbeits- und Lebensverhältnissen entgegenblicken.
Mit der von PISA definierten Risikogruppe als Ausgangspunkt soll auch in anderen wissenschaftlichen Disziplinen nach Begriffen und Konzepten von Risikogruppen gesucht werden. Die Frage dabei ist, welche Risikogruppen andere Disziplinen, wie die Soziologie oder die Psychologie, insbesondere die pädagogische Psychologie, identifizieren und beschreiben, die für diese Arbeit relevant sein könnten. Der disziplinäre Ursprung der PISA-Studie sind die Bildungssoziologie und die empirische Bildungsforschung. Sie hat damit methodologisch und bezogen auf die Arbeitsbereiche der Autoren Nähe zur Erziehungswissenschaft, Psychologie und Soziologie.
Mit dem ersten Überblick über das Forschungsfeld und nach der explorativen Sichtung erster Literatur bietet die Soziologie die meisten Bezüge, wenn es darum geht, einerseits nach Risikogruppen in der Schule und andererseits auch nach Risikogruppen in Bezug auf Mediennutzung und Lebenswelt zu suchen. Die Soziologie bietet die gut erarbeiteten Konzepte „soziale Ungleichheit“ und „soziale Exklusion“ an, die auf der Suche nach einer „neuen Unterschicht“ naheliegend und erklärungsmächtig scheinen. Generell scheint das Feld der Sozialstrukturanalyse sehr geeignet, um diese „neue Unterschicht“ zu entdecken und zu beschreiben. Eine der Annahmen ist hier, dass es einen Zusammenhang zwischen einer „neuen Unterschicht“, den Risikogruppen, die PISA beschreibt, und möglicherweise weiteren gefährdeten Gruppen Jugendlicher gibt. Der Medien- und Sozialisationsforscher Lothar Mikos von der Universität Potsdam gibt dabei einen entscheidenden Hinweis darauf, dass es nicht nur um individuell scheiternde Menschen geht. Bei den Risikolernern, die auch im Zusammenhang mit einer „neuen Unterschicht“ gesehen werden müssen, geht es um eine „kulturelle Haltung“ (E. Engel & DPA, 2006), das heißt, dass es möglicherweise bei der Unterschicht – oder in der Übertragung bei den Risikolernern – um einen ganzen Lebensstil geht. „Die so genannte Unterschicht grenze sich mental selbst aus, indem sie gesellschaftlich erwünschte Haltungen wie Flexibilität, Mobilität, Wissenshunger oder Multimedia-Begeisterung nicht annehme“ (ebenda).
Der Ausgangspunkt der Arbeit, wie oben beschrieben, liegt in der Beschreibung eines Phänomens mit dem Kern, dass es scheinbar eine Gruppe Jugendlicher gibt, die einerseits große Schwierigkeiten mit Institutionen wie der Schule haben und andererseits auffällige Mediennutzungsmuster haben. So scheint dabei die finanzielle Lage der Jugendlichen eine mehrschichtige Rolle zu spielen. Die Jugendlichen und/oder deren Familien geben für den Lebensunterhalt scheinbar recht wenig Geld aus, andererseits ist ihre medientechnische Ausstattung zu Hause recht gut. Sie haben Fernseher in ihren Zimmern, besitzen Handys und nutzen Computer. Auf der Seite der Institutionen gibt es Jugendliche, die sich scheinbar gegen Schule stellen, in ihr nicht zurechtkommen, schlechte Noten erzielen und schlimmstenfalls ohne einen qualifizierten Abschluss die Hauptschule verlassen.
Um diese Jugendlichen als Gruppe zu verstehen, ist es nötig, sie zu benennen. An diesem Punkt noch unklar, ob die Gruppe derjenigen, die in der Schule Probleme haben, eine andere ist als die Jugendlichen deren Mediennutzungsmuster auffällig sind. Ebenso ist unklar, in welchem Verhältnis diese Gruppen zueinander stehen.
Die alltagstheoretische Debatte und öffentliche Diskurse legen teilweise nahe, dass bestimmte Mediennutzungsmuster wie häufiges und langes Fernsehen oder das Spielen von sogenannten Killerspielen bestimmte negative Folgen für Kinder und Jugendliche haben. 1 Andererseits gibt es öffentliche Diskurse, die darüber berichten, welch geringe Aussichten Jugendliche bei der Suche eines Ausbildungsplatzes haben, wenn sie von einer Hauptschule kommen. Noch geringer scheinen demnach die Chancen auf eine Ausbildung bzw. einen Job, wenn sie keinen qualifizierten Abschluss haben. Die längerfristigen Folgen einer solchen Entwicklung kann man dann an der Diskussion um einen Fachkräftemangel, die die Industrie führt, erahnen. Der Zusammenhang zwischen dem Bildungsgrad und den Chancen auf eine berufliche Zukunft liegt damit auf der Hand. Die Jugendlichen scheinen aus mehreren unterschiedlichen Gesichtspunkten in einer schwierigen bis riskanten Gemengelage zu stecken. Markant ist dabei, dass es um die Jugendlichen herum und in ihrer Entwicklung diverse Risiken gibt, denen sie ausgesetzt sind. Um diese Gruppen Jugendlicher zu fassen, ist es aus dieser Perspektive sinnvoll, von „Risikogruppen“ zu sprechen, insofern aus der öffentlichen Debatte auch hervorgeht, dass es keinesfalls um alle Jugendlichen geht. Da viele Jugendliche recht erfolgreich sind, kann man die Gruppen, die besonders von Risiken bedroht sind, einschränken, sie zahlenmäßig erfassen und beschreiben.
In einer pädagogischen Debatte rücken Kinder und Jugendliche, die eine Unterstützung in ihrer Entwicklung nötig haben oder Hilfe bedürfen, in den Mittelpunkt. Wenn nun aber von einer Risikogruppe die Rede ist, wird die Bedrohung durch Risiken in den Fokus gehoben. Alle pädagogischen Bemühungen konzentrieren sich auf die Bewältigung der Risiken. Was aber möglicherweise bei dieser Perspek tive– der Einstufung als „Risikogruppe” –unklar bleibt, ist das Selbstverständnis der Jugendlichen. In der konkreten Arbeit mit Jugendlichen ist es möglicherweise sinnvoll, diesen Begriff zu vermeiden. In einer eher theoretischen und empirischen Betrachtung scheint es dagegen sinnvoll, die Zielgruppe der Betrachtung so direkt wie möglich mit einem Begriff zu benennen, der die Gruppe auch inhaltlich zu beschreiben vermag. In einer wissenschaftlichen Betrachtung soll der Begriff der „Risikogruppe“ die Jugendlichen auf keinen Fall bewerten, sie abwerten oder sie gar stigmatisieren. Es gilt, die Risiken heutiger Jugendlicher systematisch zu betrachten und aufzudecken, um sie dann bearbeiten zu können.
Diese Risikogruppe Jugendlicher, die in der Schule Schwierigkeiten hat und für die es möglicherweise am wichtigsten ist, einen qualifizierten Schulabschluss zu erwerben, soll mit dem Begriff der „Risikolerner“ gefasst werden. So verwendet z. B. der Berliner Professor für Wirtschaftspädagogik an der Humboldt-Universität zu Berlin Jürgen van Buer diesen Begriff, um ausgehend von den Ergebnissen der PISA-Studien Forderungen für die Umgestaltung der beruflichen Ausbildung Jugendlicher zu formulieren. 2
Der Sender TV Berlin stellte zu diesem Thema ein Video mit dem Titel „Berufliche Integration von Jugendlichen“ am 1. November 2007 online (tv-berlin, 2007) und beschrieb es unter anderem mit dem Stichwort „Risikolerner“. Das Video beschreibt das Modellprojekt des Lehrstuhls für Wirtschaftspolitik der Humboldt-Universität zu Berlin mit den Worten:
„Dass Bildung über Zukunft entscheidet, weiss [sic] heute jedes Kind. Sollte man meinen – die Realität sieht anders aus: Fast 25 Prozent aller Jugendlichen eines Jahrgangs gelten als sogenannte ‚Risikolerner‘. Sie verlassen die Schule ohne oder nur mit einem einfachen Hauptschulabschluss. Seit 1998 gibt es in Berlin das Modellprojekt der sogenannten modularen dualen Qualifizierungsmassnahme [sic]. Das Ziel ist, Sorgenkinder auf diese Weise doch noch zu einem Abschluss zu bringen.“ (ebenda)
Auch die Deutsche Gesellschaft für Fremdsprachenforschung verwendet in ihrem Positionspapier „Kompetenzorientierung, Bildungsstandards und fremdsprachliches Lernen – Herausforderungen an die Fremdsprachenforschung“ vom Oktober 2008 ausgehend von den Ergebnissen der PISA-Studien den Begriff der Risikolerner:
„Durch Kompetenzorientierung und Bildungsstandards soll schulisches Lernen nachhaltig gefördert und verbessert, die Zahl der Risikolerner reduziert und das Gefälle an Bildungschancen zwischen den Ländern der Bundesrepublik Deutschland vermindert werden.“ (Vorstand und Beirat der DGFF, 2008, S. 1)
Wiederum mit Bezug auf die Ergebnisse der PISA-Studien benennt die Website medien+bildung.com gGmbH, unter Verantwortung von Katja Friedrich, Risikolerner als Kernzielgruppe von Projekten, die Jugendlichen die Möglichkeit bieten, Handy als Lernressource zu verwenden. Dies soll vor allem dadurch erreicht werden, dass die Schule das Handy als Brücke zur Alltagswelt der Jugendlichen aufgreift:
„Wie die PISA-Studien zeigen, verliert die Schule vor allem bei Jungen der Unterschicht und aus Migranten-Familien die Möglichkeiten, sie erfolgreich zum Lernen in der Schule anzuleiten, obwohl diese Schüler im Alltag mit Medien und im Rahmen von Unterhaltung sehr wohl informell lernen. Für diese Gruppe der Risiko-Lerner aber auch für schulisch erfolgreiche Kinder und Jugendlichen [sic] bietet sich das Handy als Kommunikationsbrücke zwischen informellem Alltagslernen und dem Lernen an, das der Lehrplan vorgibt.“ (Bachmair & medien+bildung.com, 2009)
Hierzu sei angemerkt, dass die Website medien+bildung von Prof. Dr. Ben Bachmair informiert und unterstützt wird. Daher ist eine deutliche Nähe zur Arbeit der London Mobile Learning Group (LMLG) erkennbar.
Der Begriff Risikolerner umfasst also die Risikogruppen, die die PISA-Studien formulieren, und er fokussiert die Jugendlichen als Lerner, die aufgrund ihres Alters in Schule oder Ausbildung eingebunden sind. Der Begriff fokussiert dabei auch, dass Lernen für Jugendliche und für den Entwicklungsabschnitt Jugend die prägnanteste und bedeutendste – weil schulisch-qualifikatorische – Form der Aneignung von Welt ist. Die Diskussion konzentriert sich also auf Jugendliche, die in ihrer Schulzeit bzw. Schulpflicht sind oder die sich in Ausbildung befinden. Kennzeichnend für dieses Jugendalter ist die Schule, die sie zu Lernern macht. Andererseits ist das Lernen an dieser Stelle auch Kennzeichen dieses Jugendalters allgemein. Die Jugendlichen, die von dieser Arbeit betrachtet werden, stehen also einer Gemengelage aus verschiedenen Risiken gegenüber und sind andererseits Lerner, die in der Schule einen gewissen Erfolg haben müssen, um nicht schon früh in ihrem Berufsleben von staatlicher Unterstützung leben zu müssen. Sie sind also insofern Risikolerner mit einer gewissen Distanz zur Schule, zum Unterricht, zum Lerninhalt, der unterrichtet wird, oder zum System Schule. Aus diesem Blickwinkel scheint es damit möglich, unabhängig von Schulformen und Schultypen, Regionen und Altersgruppen Risikolerner zu betrachten bzw. entsprechende Strukturen aufzudecken.
2.2.1 Ausgangspunkt: Distanz zur Schule
Innerhalb der Gruppe der Jugendlichen gibt es besondere Risikogruppen, die eine problematische Schullaufbahn haben. Die große Zahl von etwa 8 % der Jugendlichen in Deutschland, die nach Beendigung der Hauptschule über keinen Schulabschluss verfügen (Autorengruppe „Bildungsberichterstattung“, 2008, S. 88), macht dabei die Bedeutung der Schullaufbahn deutlich. Aber nicht nur generell auf die Laufbahn bezogen, sondern auch innerhalb der Schule und während des Unterrichts spüren Lehrer, dass es einige Schüler gibt, die weniger gut in das System schulischer Erziehung passen oder sich nicht einpassen wollen. Lehrer sprechen von zeitlich verminderten Aufmerksamkeitsspannen, Schüler könnten sich nicht mehr auf den Unterricht und nicht mehr gezielt auf Aufgaben konzentrieren usw. Hierzu sei lediglich eine kurze Google-Suche mit dem Suchbegriff „Aufmerksamkeitsspanne“ 3 angeregt. Auch hier werden verschiedene neue Medien wie das Internet oder das Handy dafür verantwortlich gemacht, dass eine vormals längere Zeit der gezielten Aufmerksamkeit nun zugunsten anderer Dinge verkürzt wird und dem klassischen schulischen Lernen dadurch zu wenig Aufmerksamkeit übrigbleibt.
Um zu vermeiden, dass Schüler die Schule schwänzen, wurde in einigen deutschen Bundesländern die Polizei beauftragt, junge Menschen, die sich zu Schulzeiten in der Stadt außerhalb der Schule bewegen, in die Schule zurückzubringen. So heißt es z. B. in einem entsprechenden Bericht auf der Website des hessischen Rundfunks, dass es Ziel sei, „Bildungsdefizite zu verhindern und kriminelle Karrieren erst gar nicht entstehen zu lassen“ (roro, 2005). Die Polizei würde demnach „notorische Schulschwänzer“ und „Schulverweigerer“, die mehr als 10 Tage die Schule unentschuldigt nicht mehr besucht haben oder zwischen 8 und 13 Uhr außerhalb der Schule aufgegriffen werden und als Schulschwänzer bereits bei der Schulbehörde gemeldet sind, in die Schule zurückbringen. Andere Bundesländer wie Berlin, Hamburg und Bayern verfahren ähnlich, und es bleibt fraglich, ob eine solche „Quasi-Kriminalisierung“ die Distanz der Schüler zur Schule verringern kann.
Die Distanz zur Schule ist ein eher alltagsgeleitetes Konzept der Beziehung der Risikolerner zur Schule. Dieses Konzept geht davon aus, dass Schule bzw. Unterricht und Lernen für Risikolerner keineswegs im Zentrum der Lebenswelt steht. Mit Blick auf Schulschwänzer geht z. B. eine Pressemeldung der Pressestelle des Ministeriums für Bildung und Frauen des Landes Schleswig-Holstein 4 davon aus, dass Schulschwänzer eine immer größer werdende Distanz zur Schule bekämen, wenn es nicht gelänge, sie wieder zurückzuholen.
In der Perspektive der Schulforschung wird dieses Konzept wissenschaftlich untermauert und bestätigt von Helmut Fend. In seinem Buch „Neue Theorie der Schule“ (2008) macht er deutlich, dass mit steigender autoritärer Kontrolle und Regulierung durch Lehrer das Selbstvertrauen der SchülerInnen gemindert, die Angst der SchülerInnen vor den Lehrkräften bestärkt und unterschwelliger Widerstand und Gegenaggression eher gefördert werden (Fend, 2008, S. 111), was sie in eine „emotionale Distanz zur Schule“ führt (ebenda, S. 68).
2.2.1.1 Risikolerner in der Perspektive Schulwechsler und Schulschwänzer
Risikolerner kommen prinzipiell in allen Schulformen vor. Die Risikolerner, die in den PISA-Studien (siehe Kapitel ) schlecht abgeschnitten haben, findet man in der Hauptschule, in der Realschule und im Gymnasium wieder. Auch die Schüler, die zuvor mit „Distanz zur Schule“ beschrieben wurden, haben keinen spezifischen Schulartenbezug. Ziel ist es aber, Risikolerner zahlenmäßig genauer zu bestimmen sowie möglichst als Lebensstil zu erfassen und zu beschreiben, wozu es nötig scheint, auf der soziologisch-strukturanalytischen Ebene gesellschaftliche Muster auszumachen und in ihnen Risikolerner wiederzuentdecken.
Schulmüde Schüler und Schulschwänzer
Der Ansatz, dass Schüler eine gewisse, nicht zu unterschätzende Distanz zur Schule haben, legt die Betrachtung derjenigen nahe, die schulmüde sind oder der Schule physisch fern bleiben und den Unterricht schwänzen. Dieser Abschnitt ordnet einige Begriffe, die die Distanz zur Schule emotional oder physisch ausdrücken, und versucht, diese Begriffe in Bezug auf die Fragestellung und die systematische Suche nach Risikolernern zu ordnen. Das Ordnungskriterium hierfür ist die Nähe zur Schule bzw. das graduelle Sich-Entfernen von der Schule durch die Schüler, wobei der Begriff ’schulmüde‘ eine größere Nähe bzw. geringere Distanz zur Schule beinhaltet, weitere Entfernung drücken Begriffe wie ’schulfern‘ und ‚Schulverweigerung‘ bis hin zu ‚Schulschwänzer‘ aus, die unter dem Oberbegriff „Schulabsentismus“ gefasst werden können. Schülergruppen, die man unter den Begriffen „marginalisiert“ oder „NEET – Not in Education, Employment or Training” führt, werden in Kapitel besprochen. Sie sind Risikolerner, die sich bereits weitgehend vom Bildungssystem verabschiedet haben und insofern bereits außerhalb von Schule stehen.
Die Diskussion um Schulmüdigkeit und Schulverweigerung ist bereits seit einigen Jahren Thema von Integrationsprojekten vor allem im Rahmen der Sozialpädagogik. So fand z. B. am 26. / 27. September 1995 in Bonn unter der Leitung des Landschaftsverbands Rheinland (Landesjugendamt) der Kongress „Schule: statt Pflicht – Flucht“ statt. Das Thema Schulverweigerung wurde in diesem Fall ausgehend von der Jugendsozialarbeit und den Beratungsstellen des NRW-Landesjugendplanprogramms „Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen im Übergang von der Schule in den Beruf“ (Landschaftsverband Rheinland, 1996, S. 3) bearbeitet. Diese Beratungsstellen „wenden sich seit vielen Jahren an Schülerinnen und Schüler, die aus dem Regelschulsystem herausfallen“ (ebenda). Weiteren Anstoß zu diesem Kongress gaben sechs Modellversuche mit jeweils acht Schülern, „die zum Teil schon zwei bis drei Jahre der Schule fernbleiben“ (ebenda), mit dem Ziel, weitere Projekte und Ergebnisse aus anderen Projekten im Bundesgebiet zu sammeln. Schon für diese Veranstaltung galt, dass es einen engen Zusammenhang zwischen Hauptschule und Schulmüdigkeit gibt:
„Hinzu kommt, dass die Hauptschule die Zielgruppe der schulmüden Schülerinnen und Schüler integrieren soll, die zwar noch schulpflichtig sind, für die jedoch aufgrund meist chronifizierter Mißerfolgskarrieren kaum noch positive Schulaussichten bestehen.“ (Landschaftsverband Rheinland, 1996, S. 12)
Hieran wird deutlich, dass schulmüde Jugendliche noch in das Bildungssystem integriert sind und aus pädagogischer Sicht der Hauptschule der wesentliche Handlungsauftrag zukommt. Diese Dokumentation definiert Schulverweigerung über die relative Häufigkeit an Fehltagen eines Schülers pro Schuljahr. So fehlten etwa ein Viertel aller Hauptschüler zehn oder mehr Tage im Jahr mit der Tendenz, dass die Schüler dem Unterricht umso häufiger fernblieben, je älter sie waren und in je höheren Klassenstufen sie waren.
Ein weiteres wesentliches Projekt, das sich mit der Thematik auseinandersetzt, ist das „Projekt: Netzwerk Prävention von Schulmüdigkeit und Schulverweigerung“ des Deutschen Jugendinstituts (DJI). Das Ziel des Projektes ist, sich „mit den Ursachen und den Folgen von Schulmüdigkeit und Schulverweigerung“ auseinanderzusetzen und „Informationen über Ansätze, Strategien und Methoden zur Prävention von Schulabbrüchen und Ausbildungslosigkeit zusammenzustellen und so aufzubereiten, dass sie von Politik und Praxis für wirksame Verbesserungen im schulischen Alltag genutzt werden können“ (Hofmann-Lun, 2009). Diesem und dem Landesjugendplanprogramm aus Nordrhein-Westfalen ist gemeinsam, dass sie die Hauptschule in den Blick nehmen, am Übergang vom Schulleben in das Berufsleben, mit dem Ziel, dass Jugendliche wenigstens einen qualifizierten Hauptschulabschuss erlangen, um damit bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben, und das Risiko der Arbeitslosigkeit dadurch verringert wird.
Anzeichen von Schulmüdigkeit
Als Anzeichen von Schulmüdigkeit beschreibt Andrea Michel (2005, S. 14ff) im Rahmen des DJI-Projekts folgende Indikatoren:
-
Leistungsveränderungen: „Leistungsveränderungen […], die sich die Lehrkraft nicht erklären kann“.
-
Fehlzeiten: „Sowohl unentschuldigte als auch entschuldigte Fehltage müssen genau zur Kenntnis genommen werden, auch z. B. gehäufte Verspätungen, Fehlen in einzelnen Fächern bzw. der ersten Stunde oder entschuldigtes Fehlen mit Attesten wechselnder Ärzte“.
-
Verhaltensweisen: „auffällige Verhaltensweisen wie Störungen des Unterrichts oder passives, zurückgezogenes Verhalten“, sich „schulischen Unterrichts entziehen oder aktiv widersetzen“.
-
Änderungen im Sozialverhalten: „(Umgang mit Lehrkräften, Mitschülerinnen und Mitschüler, Verhalten im Unterricht oder auch nach Schulende) oder Arbeitsverhalten (sinkende Mitarbeit im Unterricht, Unregelmäßigkeiten und häufiges Fehlen von Hausaufgaben, Zustand der Arbeitsmaterialien)“.
-
Mangelnde Integration: „mangelnde Integration in das Klassengefüge und Probleme mit (oder Angst vor) Mitschülerinnen und Mitschülern [kann, K.R.] ein Grund für das Fernbleiben vom Unterricht sein“.
Ursachen von Schulverweigerung und Schulmüdigkeit
Das von Karlheinz Thimm, mittlerweile Professor für Soziale Arbeit an der Evangelischen Fachhochschule Berlin, im Jahr 2000 als Dissertation verfasste Buch „Schulverweigerung“ gilt als erste große Zusammenfassung und Überblick zum Thema. Auch dieses Werk ist in der Perspektive der Sozialpädagogik entstanden und fokussiert im Wesentlichen Hauptschüler und Sonderschüler an der Schnittstelle zwischen Ende der Pflichtschulzeit, die es zu erfüllen gilt, und dem Berufseinstieg, der erst dann erfolgreich sein kann, wenn Schüler einen qualifizierten Hauptschulabschluss vorweisen können.
Auch die Arbeit von Heinrich Ricking wurde als Dissertation verfasst und im Jahr 2003 vorgelegt. Sie ist zeitlich teilweise parallel zur Dissertation von Karlheinz Thimm, aber im Rahmen der Erziehungswissenschaft als Metaanalyse von fast 250 einschlägigen Beiträgen aus dem englischen und deutschen Sprachraum entstanden. Diese beiden Arbeiten ergänzen sich daher als Standardwerke zum Thema Schulverweigerung und Schulabsentismus.
Hauptsächlich unter Rückbezug auf Karlheinz Thimm (2000) und Heinrich Ricking (2003) fasst Elke Schreiber (2005, S. 12ff) die Ursachen und Problemlagen für das Problem Schulverweigerung und Schulmüdigkeit zusammen:
-
Familiäre Problemlagen: „soziale Probleme im Elternhaus und sozial benachteiligte Milieus“ begünstigen „eher schulaversives Verhalten, sodass Schüler/innen aus benachteiligten Verhältnissen häufiger zu Absentismus tendieren und Schulverweigerer überdurchschnittlich stark aus sozial schwachen Familien kommen (Ricking 2003, S. 140ff)“.
-
Probleme im Bildungssystem:
-
„[D]ie schulischen Inhalte sind oftmals ‚lebensfern’“.
-
„Häufig sind die Schüler/innen dem Leistungsdruck durch Schule oder Eltern nicht gewachsen“.
-
„Problematische Gruppenkonstellationen in den Schulklassen, Ängste vor anderen Jugendlichen oder den Lehrern“.
-
„[D]ie Wahl der jeweiligen Schulform kann zu Über- bzw. Unterforderungen der Schüler/innen führen. Sogenannte Abstiegskarrieren – Durchlauf von höheren zu niederen Schultypen – sind die Folge. Dieser schulische ‚Abstieg‘ zieht sich vom Gymnasium bis zur Hauptschule durch“.
-
-
Persönlichkeitsmerkmale:
-
„Krisen im emotionalen Bereich, Kontaktschwierigkeiten, mangelnde Frustrationstoleranz, (Versagens-)Ängste, Minderwertigkeitsprobleme“.
-
„Angst vor anderen Jugendlichen, vor den Eltern und Lehrern, vor der Zukunft, fehlenden Perspektiven, unsicheren Ausbildungs- und Beschäftigungschancen“.
-
Für die aktuelle Betrachtung und für die Suche nach Risikolernern bleibt festzuhalten, dass in der Forschung von Thimm und Ricking großes pädagogisches Potenzial für die Förderung der Risikolerner steckt. Einschränkend muss man feststellen, dass sich Schulverweigerung nicht auf eine bestimmte soziale Gruppe beschränken lasst: „Schulabsentismus kommt nach Analyse der einschlägigen Befunde in allen sozialen Schichten und familiären Konstellationen vor“. (Ricking, 2003, S. 141)
Ricking benennt an dieser Stelle jedoch die Tendenz, dass „Schüler aus benachteiligten Verhältnissen der Unterschicht häufiger zu Absentismus tendieren“ (ebenda) und es einen Zusammenhang zwischen dem „Schulbesuchsverhalten“ und „subkulturellen Sozialisationsformen“ gibt (ebenda).
Andere Risikolerner: Hochbegabte Underachiever
Einer der Forschungsschwerpunkte der Schweizer Professorin für Erziehungswissenschaft Margrit Stamm ist der Zusammenhang zwischen Schulabsentismus und Hochbegabung. Sie stützt sich mit dem Begriff Schulabsentismus auf die Arbeiten von Thimm und Ricking und ergänzt diese durch die Forschung zu Hochbegabung und Underachievement. Nach einer Längsschnittstudie mit 366 Jugendlichen aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein konnte Stamm zwei wesentliche Schülertypen identifizieren:
-
„Die Blaumacher sind Jugendliche mit hohem intellektuellem Profil, bei denen Schulabsentismus eher ein strukturelles, die Schul- und Unterrichtsqualität, vor allem jedoch auch die eigenen ausserschulischen Aktivitäten tangierendes Problem darstellt.“ (Stamm, 2005, S. 13)
-
„[D]ie Distanzierten, die aufgrund ihrer deutlichen Schulaversion und ihrer häufig gebrochenen Schulbiographien zwar zu der in der Fachdiskussion prominent vertretenen Risikogruppe schulabsenter Jugendlicher gehören, im Zusammenhang mit überdurchschnittlicher Begabung bis anhin jedoch kaum beachtet worden sind.“ (ebenda)
Für die Gruppe der Distanzierten stellt Stamm fest, dass diese bereits früh ihre Schulkarriere mit hohen Fehlzeiten begonnen haben und damit ein deutlicher „Leistungsabfall einher ging“ (ebenda). Sie fallen daher in der Schule nicht mehr durch gute Noten auf und dürften daher eher durchschnittliche Schulabschlussquoten und -abschlüsse erreichen. Festzuhalten bleibt auch, dass Schule in deutlicher Konkurrenz mit außerschulischen alternativen Aktivitäten steht (Ricking, 2003, S. 83; Stamm, 2005, S. 13; Thimm, 2000, S. 199ff). Hinzu kommt, dass Schulschwänzen auch ein Akt des Protestes gegen Schule sowie gegen Lehrer bzw. gegen den Unterrichtsstoff sein kann (Ricking, 2003, S. 69; Thimm, 2000, S. 87ff).
2.2.1.2 Individuenzentrierte Ansätze zu Risikolernern aus der pädagogischen Psychologie
Selbstkonzept und Fähigkeitskonzept
In Bezug auf Risikolerner gilt die Förderung eines positiven Selbstkonzepts als zentrales Ziel der pädagogischen Psychologie, vor allem in Bezug auf benachteiligte Gruppen und die von ihnen erfahrene soziale Ungleichheit. Dies betont Herbert W. Marsh, einer der bedeutendsten Vertreter der pädagogischen Psychologie, in seinem Gasteditorial für die Zeitschrift für Pädagogische Psychologie (Marsh, 2005). Dort erklärt er zur Bedeutung des Selbstkonzepts allgemein, dass Menschen mehr erreichen und bessere Ergebnisse erzielen, wenn sie sich in dem, was sie machen, kompetent fühlen, selbstsicher sind und ein positives Gefühl über sich selbst haben (Marsh, 2005, S. 119). Mit Bezug auf die soziale Bezugsnormorientierung erklärt Marsh, dass negative Big-Fish-Little-Pond-Effekte dann auftreten können, wenn gleichermaßen begabte Schüler, die niedrigere akademische Selbstkonzepte haben, sich mit Schülern vergleichen, die bessere Schulnoten und höhere Selbstkonzepte haben. Gleiches gilt umgekehrt, wenn sich Schüler mit hohem akademischen Selbstkonzept mit schlechteren Schülern vergleichen. Das akademische Selbstkonzept von Schülern mit schlechteren Schulleistungen wird also gefördert, wenn sie in einer Klasse sind, deren mittleres Leistungsniveau eher niedrig ist, sodass ihr eigenes Leistungsniveau im Vergleich zu den Mitschülern dadurch angehoben wird. Im Gegensatz dazu sind Schüler mit niedrigeren Schulleistungen und -noten in Klassen mit hohem Leistungsniveau in Bezug auf ihr akademisches Selbstkonzept eher im Nachteil (ebenda).
Lernmotivation
In seinem Gasteditorial im Jahr 2004 zur Ausgabe 18(2) der Zeitschrift für Pädagogische Psychologie fasst Manfred Hofer vier wesentliche theoretische Traditionen der Lernmotivation zusammen. In seinem Artikel geht es ihm zentral um die Frage, wie Schüler mit den Interessen für außerschulische Aktivitäten umgehen, die in Konkurrenz zum schulischen Lernen stehen. Dieser Ansatz scheint für die Betrachtung der Risikolerner nützlich zu sein, da man ihnen in der Linie der bisherigen Betrachtung einerseits eine gewisse Müdigkeit gegenüber Schule eingestehen muss und andererseits durchaus danach fragen sollte, was Risikolerner in ihrer Freizeit machen bzw. welche Erklärungsmodelle die pädagogische Psychologie hierfür bietet.
Hofers grundlegende Kritik ist, dass der Mainstream der psychologischen Motivationsforschung gesellschaftliche Wandlungsprozesse, die letztlich auch schulisches Lernen verändert haben und verändern, nicht in den Blick nimmt. „Will man wissen, wie Schüler akademische Aufgaben und Freizeitinteressen vereinbaren oder darin scheitern, muss man den kulturellen Kontext, in dem sie aufwachsen, beachten.“ (Hofer, 2004, S. 79)
Den gesellschaftlichen Wandel beschreibt Hofer zunächst mit Verweis auf die Soziologie und die veränderten „sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen“ (ebenda, S. 80). Als konkrete Beispiele nennt er „Anstieg des Lebensstandards, Globalisierung, Ausbau des Dienstleistungssektors seit den 60er und 70er Jahren, Mobilität, Verstädterung und vieles mehr“ (ebenda). In der Perspektive der Psychologie fasst er diesen Wandel als „Vermehrung der Möglichkeiten“ und „Zunahme an Komplexität“ zusammen (ebenda). Den gesellschaftlichen Wandel beschreibt er auch als Wertewandel, mit dem sich der Begriff der Leistung an sich verändert hat, in Form einer „Relativierung von Leistung hin zu mehr Wohlbefinden“ (ebenda, S. 81). Dem fügt er hinzu, dass sich im Laufe der letzten 40 Jahre auch die Ausbildungszeit verlängert hat und die „in einer Wissensgesellschaft erhöhte Bedeutung von Wissen für die Berufschancen“ (ebenda) den „Konflikt zwischen Freizeit und Schule“ (ebenda) noch verschärft hat. Die Verlängerung der Ausbildungszeit bedeutet für ihn aus psychologischer Sicht, dass die „Belohnung für schulisches Engagement in Form von beruflichem Erfolg“ (ebenda) weit in der Zukunft liegt und das „Eintreffen der Belohnung […] infolge verringerter Berufschancen zudem als unsicher empfunden“ wird (ebenda). Hofer vermutet, dass dies „die ausgeprägte Gegenwartsorientierung Jugendlicher verstärken“ könnte (ebenda).
Mit der Theorie der Leistungsmotivation beschreibt Hofer den ersten der vier Grundzüge der Motivationstheorien. Zusammenfassend beschreibt er, „dass Menschen generell geneigt sind, Leistungssituationen aufzusuchen, um darin mit ihrem Handeln erfolgreich zu sein. […] Für das Erzielen der mit dem Erfolg verbundenen positiven Gefühle, Attributionen und Selbstbewertungsfolgen werden lange Arbeit und Anstrengung in Kauf genommen“ (ebenda, S. 82). Weiter wirft er der Psychologie kritisierend vor, die Wandlungen in der Gesellschaft nicht wahrgenommen zu haben und diesen Ansatz auf den Bereich der Leistung zu reduzieren, ohne mitzubedenken, dass „neben Leistungs- und Erfolgswerten solche des Wohlbefindens und der Selbstaktualisierung bedeutsam sind“ (ebenda). Solche Ansätze sollten in der Psychologie „zur Erklärung veränderter schulischer Motivation“ einbezogen werden (ebenda).
Unter der Überschrift „Flow, Tätigkeitsanreiz und Interesse“ fasst Hofer die zweite Gruppe der Motivationstheorien zusammen, die auf der Annahme basieren, dass „Menschen Situationen aufsuchen, in denen sie Freude an einer Tätigkeit oder einer Sache empfinden“ (ebenda, S. 83). Im Verhältnis zu den Theorien der Leistungsmotivation betont Hofer, dass die Interessentheorie, die als einzige eine „genuin pädagogisch-psychologische Entwicklung“ (ebenda) darstellt, in einer Zeit entstanden ist, „in der Wohlbefinden und Selbstverwirklichung von den Menschen als Werte zunehmend anerkannt wurden“ (ebenda). Der Interessentheorie gesteht er zu, dass sie erklärungsmächtig sind, um Interessen der Schüler außerhalb und in Konkurrenz zur Schule zu erklären. Er schränkt jedoch ein, dass diese Theorien nicht geeignet sind, „das Insgesamt der angestrebten Ziele“ zu beschreiben, z. B. nicht-interessengeleitetes Lernen für die Schule (ebenda).
Die dritte Gruppe der Motivationstheorien, die Hofer darstellt, sind Zieltheorien. Hofer beschreibt, dass unter Zielen Zustände zu verstehen sind, „die man erreichen, aufrechterhalten oder vermeiden will“, und Menschen mehrere Ziele „in unterschiedlichen Lebensbereichen“ gleichzeitig – „von momentanen Anliegen bis zu Lebenszielen“ – verfolgen können (ebenda, S. 83). Nachdem Hofer für die pädagogische Psychologie konstatiert, dass diese die Zieltheorie bislang kaum verfolgt hat, formuliert er für Risikolerner relevante Forschungsfragen, z. B.: „Wie stark fühlen sich Schüler an verschiedene Ziele gebunden (commitment)? Wie reagieren wohlbefindensorientierte Schüler auf Misserfolg? Wie gehen Schüler mit Zielkonflikten um?“ (ebenda, S. 84). Relevant könnte hierbei die Frage nach Zielkonflikten sein, die laut Hofer „mit herabgesetzter Handlungseffizienz und reduziertem Wohlbefinden“ einhergeht (ebenda).
„Ziele, die nicht in konkreten Handlungsschritten ausformuliert werden, beeinträchtigen die Effizienz. Menschen, die sich langfristige Ziele setzen und diese planvoll verfolgen, scheinen mit ihrem Leben zufriedener zu sein und sich wohler zu fühlen als Personen, die sich vorwiegend mit gegenwärtigen Tätigkeiten auseinandersetzen“. (ebenda)
Fazit und Kritik
Die individuenzentrierten Ansätze der pädagogischen Psychologie erfreuen sich vor allem in der schulischen Pädagogik großer Beliebtheit. Dort dienen sie, wie z. B. in den PISA-Studien, der Leistungsmessung und der Vorhersage akademischer Leistungsentwicklung. Doch selbst die hier unvollständige und lediglich kursorische Betrachtung der Themenfelder macht deutlich, dass die Frage nach der Schulform in den Hintergrund tritt. So macht es für die Diagnostik und die Förderung scheinbar keinen Unterschied, ob Kinder und Jugendliche an der Hauptschule oder dem Gymnasium lernen. Im Gegenteil: Bei der Durchsicht der Themen und Artikel scheint das Gymnasium neben der Grundschule sogar bevorzugtes Forschungsfeld zu sein. Das Bildungssystem an sich wird ebenfalls kaum infrage gestellt. Wo noch die Sozialpädagogik feststellt, dass Schulmüdigkeit und Schulabsentismus eher ein Thema der Hauptschule ist und sich daher für das Bildungssystem an sich spezifische Probleme ergeben (siehe Kapitel ), bleibt das Bildungssystem von der pädagogischen Psychologie unhinterfragt.
Bei der Frage nach Risikolernern geht es nicht in erster Linie darum, Individuen auf eine Lernschwäche oder mangelnde Motivation zu untersuchen. Ebenso zu kurz gegriffen scheint die Frage nach Schulschwänzern und der Zählung von Fehltagen vom Unterricht.
Bislang bezieht sich sich Gruppe der Risikolerner recht deutlich auf die Hauptschule. Jedoch scheint die reine Betrachtung von Schularten ebenso zu kurz gegriffen, da eine große Zahl der Hauptschüler trotz der Risiken, die diese Schulart in sich birgt, den Sprung ins Berufsleben erfolgreich schafft und sogar im Schulsystem aufsteigen kann. Aus der Sicht der Pädagogik muss es bei der Betrachtung von Risikolernern um mehr gehen, als nur um eine Förderung von Individuen. Dies bedeutet eine Betrachtung von Risikolernern in der Logik der Sozialisation, einer Pädagogik, die nach den funktionellen Zusammenhängen und Verhältnissen zwischen Individuen, Gesellschaft, Bildungssystem usw. fragt. Dies legt grundsätzlich die starke Einbeziehung der Soziologie nahe, wie es auch schon im Ansatz im Artikel von Manfred Hofer geschehen ist, wobei er jedoch die Soziologie außen vor ließ, anstatt sie in die Psychologie systematisch zu integrieren. Lothar Böhnisch, Professor für Sozialpädagogik und Sozialisation an der TU Dresden, illustriert das Problem der Individuenzentrierung aus Sicht von Pädagogen:
„Denn Frust und Enttäuschung vieler Pädagogen und Pädagoginnen kommen ja vor allem daher, dass sie in der konkreten erzieherischen Interaktion in der Schule und der Jugendarbeit den Menschen suchen und treffen wollen, dass sie aber gleichzeitig spüren, dass [sic] sich stetig modernisierende Bildungs- und Beschäftigungssysteme ihnen diese menschliche Orientierung erschwert, wenn nicht gar zunehmend verwehrt.“(Böhnisch, 2003a, S. 260)
Lothar Böhnisch hat in seinem Buch „Pädagogische Soziologie“ (2003a) das Verhältnis zwischen Soziologie, Pädagogik und Erziehung genauer bearbeitet. In einer eher historischen Herangehensweise skizziert er das Selbstverständnis der Aufgaben der Soziologie in Bezug auf Bildung und Erziehung mit der „Analyse des Verhältnisses von Sozialstruktur, sozialer Ungleichheit, institutioneller Verfasstheit der Erziehung und der Bildungschancen, Lernbedingungen und Entwicklungsstilen“ (ebenda, S. 18). Die seiner Sicht nach in der Pädagogik vorherrschende historische Individuenzentriertheit ist eher eine „pädagogisch inspirierte Öffnung zum Individuum und seiner Emanzipation“ (ebenda). Mit der klaren Anlehnung an die und dem Ursprung in der Sozialisationstheorie Klaus Hurrelmanns, nämlich dem Prozess derEntstehung und Entwicklung der Persönlichkeit in wechselseitiger Auseinandersetzung mit der Umwelt und mit sich selbst als produktiver Verarbeitung innerer und äußerer Realität (Hurrelmann, 2001, S. 63),versucht Böhnisch, die Spannung zwischen Soziologie und Pädagogik zu überbrücken, indem der den Begriff der „Pädagögischen Soziologie“ einführt. So versucht Böhnisch damit, „die vorfindbaren Vergesellschaftungsformen von Kindheit, Jugend und Erziehung von unterschiedlichen soziologischen Zugängen her so zu beleuchten, dass die Möglichkeiten pädagogischer Gestaltung thematisierbar werden“ (Böhnisch, 2003a, S. 21).
Das Problem der individuenzentrierten Ansätze bzw. der Biografisierung wie sie in der Psychologie und in weiten Teilen der Pädagogik vorherrscht, muss jedoch noch schärfer diskutiert werden. So entsteht der Eindruck, dass Lernen und schulischer Erfolg allein von den Individuen abhängig sind. Das schließt ihre Motivation, ihre Disposition, ihr Selbstkonzept und ihre Willensorientierung ein. Letztlich wird damit aber auch jegliches Scheitern, Misserfolg und nicht erreichte Schulabschlüsse der Kinder und Jugendlichen auf sie selbst übertragen und ihnen dafür selbst die Verantwortung überlassen (Schweizer, 2007, S. 464). Bereits im Jahr 1988 hat H elmut Heid in folgendem viel zitierten Satz das Problem der Individualisierung schulischer Leistung problematisiert und bereits damals die Einbeziehung gesellschaftlicher Kontexte gefordert:
„Die Tatsache, daß die Forderung nach Chancengleichheit fast nur auf Personen bezogen, also an die subjektive Seite des Zusammenhangs ‚adressiert‘ wird, durch den eine Chance definiert ist, begünstigt den Eindruck, es hänge allein von diesen Individuen ab, ob und wieweit sie diese Chance nützen. Dies wiederum begründet die Annahme, es könne nur an individuellen, persönlichen Defiziten oder Defekten liegen, wenn jemand seine Chance nicht wahrnimmt oder nicht wahrzunehmen vermag. Nicht die gesellschaftlichen Kriterien, Gründe, Bedingungen und Prozesse der Erzeugung von Ungleichheit, sondern deren Opfer werden als Problem dargestellt. […] Jedes individuelle Aufstiegsbemühen impliziert ein geradezu quantifizierbares Risiko des Scheiterns.“ (Heid, 1988, S. 9f)
Biografische und individuenzentrierte Ansätze allein sind demnach kaum in der Lage, die gesellschaftliche Dynamik der sozialen Ungleichheit bzw. die Forderung nach Chancengleichheit zu beschreiben. Für den Bereich der Medienkompetenzförderung warnen Kutscher u. a. (2009, S. 17) ebenfalls davor, „die Verantwortung für den Erwerb von Medienkompetenz und für medienvermittelte Bildungsprozesse allein dem Subjekt zuzuschreiben und gesel lschaftliche Benachteiligungsstrukturen zu vernachlässigen“. Um also eine Diskussion zu vermeiden, die die Defizite individueller Jugendlicher in den Vordergrund stellt, scheint es nötig, alltägliche Aneignungspraxen der Jugendlichen, im hiesigen Fall die Aneignung alltäglicher Medien zu betonen. Dazu gehört, Medien als Kulturgüter und damit als Ressourcen für Persönlichkeitsentwicklung und Medienbildung zu betrachten, und dies aus einer gesellschaftlichen Perspektive, die den Blick für soziale Benachteiligung und soziale Ungleichheit öffnet (ebenda; Niesyto, 2010).
2.2.2 Der Diskurs um soziale Benachteiligung, Digital Divide und soziale Ungleichheit – Ein Versuch der Systematisierung
2.2.2.1 Soziale Benachteiligung, bildungsferne Milieus und Bildungsbenachteiligung
Die Pädagogik und die Soziologie haben in den letzten Jahren verstärkt hervorgehoben, dass Kinder und Jugendliche höchst unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, wenn es um die Ausstattung ihres Elternhauses geht. Gleichzeitig hat vor allem die Soziologie mit einer ihrer Kernfragestellungen nach sozialer Ungleichheit wichtige Ergebnisse zum Zusammengang zwischen Schulbildung, Bildungsbeteiligung und sozialer Herkunft geliefert und festgestellt, dass es gerade in Deutschland einen besonders ausgeprägten Zusammenhang zwischen formaler Bildung der Eltern, Einkommen der Eltern und der Schulart, die die Kinder besuchen, gibt. Dabei steht fest, dass zu den Voraussetzungen, die Jugendliche mitbringen, nicht nur die finanzielle Ausstattung gehört, sondern dass es um ein komplexes Gefüge aus Handlungskompetenzen, Bildungschancen, eben auch finanziellen Ressourcen, aber auch Einstellungen zu Kultur und Konsum im Allgemeinen geht. Kinder und Jugendliche, deren diesbezügliche Ausstattung eher dürftig erscheint und die deshalb Schwierigkeiten haben, in der Gesellschaft zurechtzukommen, versucht man mit dem Begriff „benachteiligt“ zu beschreiben. Kinder und Jugendliche kommen aus ganz unterschiedlichen Verhältnissen, haben ganz unterschiedliche Präferenzen in Bezug auf Ästhetik, Kleidung, Musik, Fernsehen, Lesen oder die Handymarke. Auf der anderen Seite besuchen sie in Deutschland unterschiedliche Schularten, von Hauptschule bis Gymnasium, und haben in Bezug auf ihre Bildungskarriere höchst unterschiedliche persönliche Zugänge und Zugangschancen. Für Kinder und Jugendliche ist es eine zentrale Aufgabe innerhalb ihrer Sozialisation, sich zwischen diesen Chancen, Angeboten und Ausstattungen zu orientieren, ganz besonders für Risikogruppen wie benachteiligte Kinder und Jugendliche. Dabei hat das Handy in den letzten Jahren eine besondere Funktion für Jugendliche im Rahmen von Sozialisation und Bildung bekommen.
Der Begriff „Benachteiligung“ ist in den Sozialwissenschaften kein fest definierter Begriff (Schroeder, 2006, S. 207f). Er dient dazu, in unterschiedlichen Zusammenhängen Schieflagen und vor allem passive soziale Mangel-, Problem- oder Fehllagen zu beschreiben. Aus Sicht der Erziehungswissenschaft hat Petra Korte (2006, S. 26f) vor allem den Aspekt der Passivität hervorgehoben. Sie betont, dass Leistungskindheit als Bevorzugungspraxis das Gegenteil zu Benachteiligung darstellt. Wo es Benachteiligte gibt, muss es auch Strukturen und Menschen geben, die zum Nachteil der Benachteiligten andere bevorzugen. Die Konkurrenz in der Bildung und Konzepte schulischer Exzellenz bedeuten das Streben nach Bevorzugung und bilden mit Benachteiligung die entsprechende Dichotomie. Bildung dient laut Petra Korte der Prävention von Benachteiligung und ist deshalb einziges Mittel gegen Benachteiligung. Es geht ihr um die Stärkung des Einzelnen durch sich selbst und darum, auf der Systemebene Bedingungen zu schaffen, in denen diese Stärkung gelingen kann.
Aus Sicht der Medienpädagogik ist der Begriff der Benachteiligung ähnlich offengehalten. Dies beschreibt Bernward Hoffmann (2006, S. 15) in tv diskurs. Hingegen versteht Horst Niesyto unter „Benachteiligung“, „wenn durch bestimmte Formen des Zugangs, der Aneignung und Vermittlung von Medienkompetenz soziale Gruppen und Schichten tendenziell ausgegrenzt werden“ (Niesyto, 2000, S. 7). Auch in dieser Definition ist der passive Aspekt des Ausgegrenzt-Werdens deutlich erkennbar.
2.2.2.2 Soziale Ungleichheit
Der Begriff der sozialen Benachteiligung innerhalb der Bezugsdisziplinen Soziologie und Pädagogik, insbesondere der Medienpädagogik, bleibt weitgehend undefiniert. Dies wird auch in jüngeren Projekten des Instituts für Film und Fernsehen (JFF) und der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) deutlich. In Projekten beider Institutionen geht es zentral um die Förderung sozial benachteiligter Gruppen. Die Frage nach der Zielgruppe, nämlich die Frage, wer genau diese Benachteiligten sind, wird dann jeweils schnell mit Hauptschülern beantwortet (Kutscher u. a., 2009; Wagner, 2008). Für eine präzisere Betrachtung und um eine genauere Personengruppe innerhalb der Gesellschaft zu benennen, bietet die Soziologie an dieser Stelle das Konzept der sozialen Ungleichheit an. Danach sind Menschen in einer Gesellschaft in Bezug auf Güter, Einkommen oder Bildung höher oder niedriger, besser oder schlechter gestellt (Hradil, 1999). Horst Niesyto bezieht sich ebenfalls auf diese zentrale Definition von Stephan Hradil. (Niesyto, 2010, S. 315). Niesyto geht davon aus, „dass soziale Benachteiligung dann vorliegt, wenn bestimmten sozialen Gruppen der Zugang zu gesellschaftlich relevanten Ressourcen, z. B. höheres Einkommen, soziale Sicherheit (Arbeitsplatzsicherheit, Gesundheitsvorsorge), aber auch Bildung, durch Schichtgrenzen und/oder Diskriminierung verwehrt bleibt oder erschwert ist“ (Niesyto, 2007, S. 156). Daraus ergibt sich der für soziale Benachteiligung entscheidende Unterschied, bei dem es um den Zugang zu Ressourcen geht. Zu diesen Ressourcen gehören Medien als Kulturgüter ebenso wie z. B. der Zugang zu Bildung in der objektivierten Form eines qualifizierten Hauptschulabschlusses. Niesyto weist deutlich darauf hin, dass Benachteiligung, ebenso wie soziale Ungleichheit, als „strukturelle Kategorie auf bestimmte Lebenslagen verweist“ (Niesyto, 2010, S. 315) und die Ausgrenzung von „Risikomilieus“ (ebenda) sogar verschärft.
Der Kasseler Soziologe Heinz Bude prägte in diesem Zusammenhang den Begriff der sozialen Exklusion. Auf der objektiven Ebene werden dabei „Prekaritäten in den Lebensbereichen persönlicher Wohlstand, Erwerbsstatus, Eingebundenheit in soziale Netzwerke, Art und Weise des Institutionenvertrauens und psycho-psychischer [sic] Gesundheitszustand erfasst“ (Bude & Lantermann, 2006, S. 235). Daneben weisen Bude und Lantermann eine subjektive Exklusionsebene aus, bei dieser geht es „um das Empfinden, dass es auf einen in der Gesellschaft nicht mehr ankommt, weshalb man sich aus der Welt der Chancen verstoßen und in eine Welt des Ausschlusses geworfen sieht“ (ebenda).
Hinter der sozialen Benachteiligung, Ungleichheit und Exklusion stehen also Risikogruppen. Im Fall von Kindern und Jugendlichen kommt hinzu, dass sie in Bildungseinrichtungen eingebunden sind, also Schüler sind, in Ausbildungsverhältnissen stecken und gezwungen sind, diese mit einem Zertifikat abzuschließen (Bude, 2008). Es entstehen prekäre Lagen, wenn 8 % der Jugendlichen nicht einmal die Hauptschule qualifiziert abschließen (Autorengruppe „Bildungsberichterstattung“, 2008, S. 89) und so kaum Chancen auf einen Ausbildungsplatz und damit auf einen finanziell gesicherten Lebensunterhalt haben. Den engen Zusammenhang zwischen der Position der Schüler in der Gesellschaft und Schule, Schulleistungen und Bildungsabschlüssen haben die PISA-Studien zur Schulleistungsmessung der OECD gezeigt (siehe Kapitel ).
2.2.2.3 Digital Divide
Speziell im Zusammenhang mit sozialer Ungleichheit und sozialer Benachteiligung steht der Begriff des Digital Divide, der digitalen Spaltung bzw. der digitalen Wissenskluft, wobei es im Kern um die Frage nach den Zugangsmöglichkeiten zum Internet oder anderen Medien geht. Der Begriff Digital Divide hat internationale und jeweils nationale Betrachtungsweisen und so findet man z. B. die Diskussion um den verhältnismäßig sehr geringen Breitband-Internetzugang in Afrika, der durch den Gebrauch von Handys kompensiert wird (ssu, 2007).
Der Schweizer Mediensoziologe Heinz Bonfadelli fasst in seinem Beitrag im Handbuch Medienpädagogik (Bonfadelli, 2008, S. 272) den Stand der Forschung zur Wissenskluft-Hypothese wie folgt zusammen:
-
Auf der Makroebene, bezogen auf einen Staat, nivellieren sich Wissensklüfte bei größer werdenden sozialen Konflikten.
-
Umgekehrt sind Wissensklüfte umso größer, je pluralistischer ein Sozialsystem ausgeprägt ist.
Für die Mikroebene fasst Bonfadelli psychologische Faktoren zusammen. So können:
-
„motivational das Themeninteresse oder
-
die subjektive Betroffenheit,
-
sozial die Eingebundenheit in Beziehungsnetze oder
-
lokale Partizipation und
-
kognitiv das vorhandene Vorwissen, Fertigkeiten der Informationsverarbeitung und informationsorientierte Mediennutzung“
zum Ausgleich von Wissensklüften beitragen (ebenda). In Bezug auf Medien fasst Bonfadelli zusammen, dass Fernsehen als knowledge-leveler fungiert, insofern es durch seine hohe Verfügbarkeit und durch das vorbeschriebene Programmspektrum für fast alle Menschen ein nachvollziehbares Wissen bereithält und damit Wissensklüfte ausgleichen könne. Ähnliches gelte für Printmedien, „sofern von den statusniedrigen Segmenten überhaupt genutzt“ (ebenda). Für Medienpädagogik und in Bezug auf das Internet fordert Bonfadelli daher, „dem Lesen als basaler Kulturtechnik Priorität einzuräumen“, da es Viellesern eher gelingt, mit differenzierteren, abstrakteren und anspruchsvolleren Wissensformen umzugehen (ebenda). Allgemein fassen Priska Bucher und Heinz Bonfadelli zusammen, dass der digitale Graben sich in bildungs- und schichtspezifischen Unterschieden in der Mediennutzung und -aneignung äußert, die sich „wiederum in sozioökonomischen Kommunikations- und Wissensklüften niederschlagen“ (2007, S. 121).
Der Begriff des Digital Divide stellt im Prinzip die Zusammenführung der sozialen Ungleichheit und der sozialen Benachteiligung mit der Perspektive auf Mediennutzung dar. Für die Förderung von Risikolernern bedeutet dies, ihnen Zugang zur Ressource Internet zu ermöglichen, da sie dies möglicherweise nicht selbst schaffen (Bachmair, 2009a, S. 180), und sie darüber hinaus, Bonfadellis Faktoren der Wissenskluft folgend, bei der Aneignung dieser Medien zu unterstützen.
2.2.2.4 Marginalisierte Gruppen
Die Risikolerner, von denen bislang anzunehmen ist, dass sie von sozialer Ungleichheit, sozialer Benachteiligung und digitaler Spaltung betroffen sind, sind wahrscheinlich auch in sogenannten marginalisierten Gruppen zu suchen. So beschreiben u. a. Ilse Marschalek, Elisabeth Unterfrauner und Claudia Magdalena Fabian vom Zentrum für Soziale Innovation in Wien Marginalisierung allgemein als eingeschränkte gesellschaftliche Teilhabe in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Kultur (2009, S. 367). Für ihr Projekt ComeIn (Online Mobile Communities to facilitate the Social Inclusion of Young Marginalised People – EU FP7) sind marginalisierte Jugendliche die Zielgruppe sozialer Inklusion, da diese Jugendlichen von mehrfacher und vielschichtig verwobener Benachteiligungen betroffen sind,daher mit komplexen Hürden umgehen müssen und weniger Ressourcen haben als andere Jugendliche. Das Projekt nimmt speziell Jugendliche in den Fokus, die zwischen 14 und 21 Jahren sind, innerhalb der Schulpflicht sind, aber außerhalb jeglicher schulischer Institutionen, und zudem Jugendliche, die nicht mehr schulpflichtig sind und sich weder in Schule, Ausbildung oder Anstellung befinden (ebenda). Zur Bestimmung, Eingrenzung und Beschreibung der Zielgruppe haben die Autorinnen folgende sieben konkrete Dimensionen der Marginalisierung zusammengestellt (Unterfrauner & Marschalek, 2009, S. 1):
-
Ökonomische Dimension,
-
Kulturelle Dimension,
-
Soziale Dimension,
-
Räumliche Dimension,
-
Institutionelle Dimension,
-
Dimension Arbeitsmarkt,
-
Dimension individueller Faktoren: intrapersonelle Faktoren, kognitive Faktoren und individuelle Bildung.
Um dieses mehrdimensionale Ressourcenmodell, das im Wesentlichen das Fehlen dieser jeweiligen Ressourcen als Bedürfnisse beschreibt, für die Förderung marginalisierter Jugendlicher nutzbar zu machen, haben die Autoren konkrete Bedürfnisse den Ressourcen, zu denen es Zugang zu schaffen gilt, gleichgesetzt.
Daraus ergibt sich ein konkretes Bild und ein Set an Förderungsmöglichkeiten, wobei die Autoren auf die Wichtigkeit hinweisen, alle aufgezählten Ressourcen gleichermaßen zu betonen.
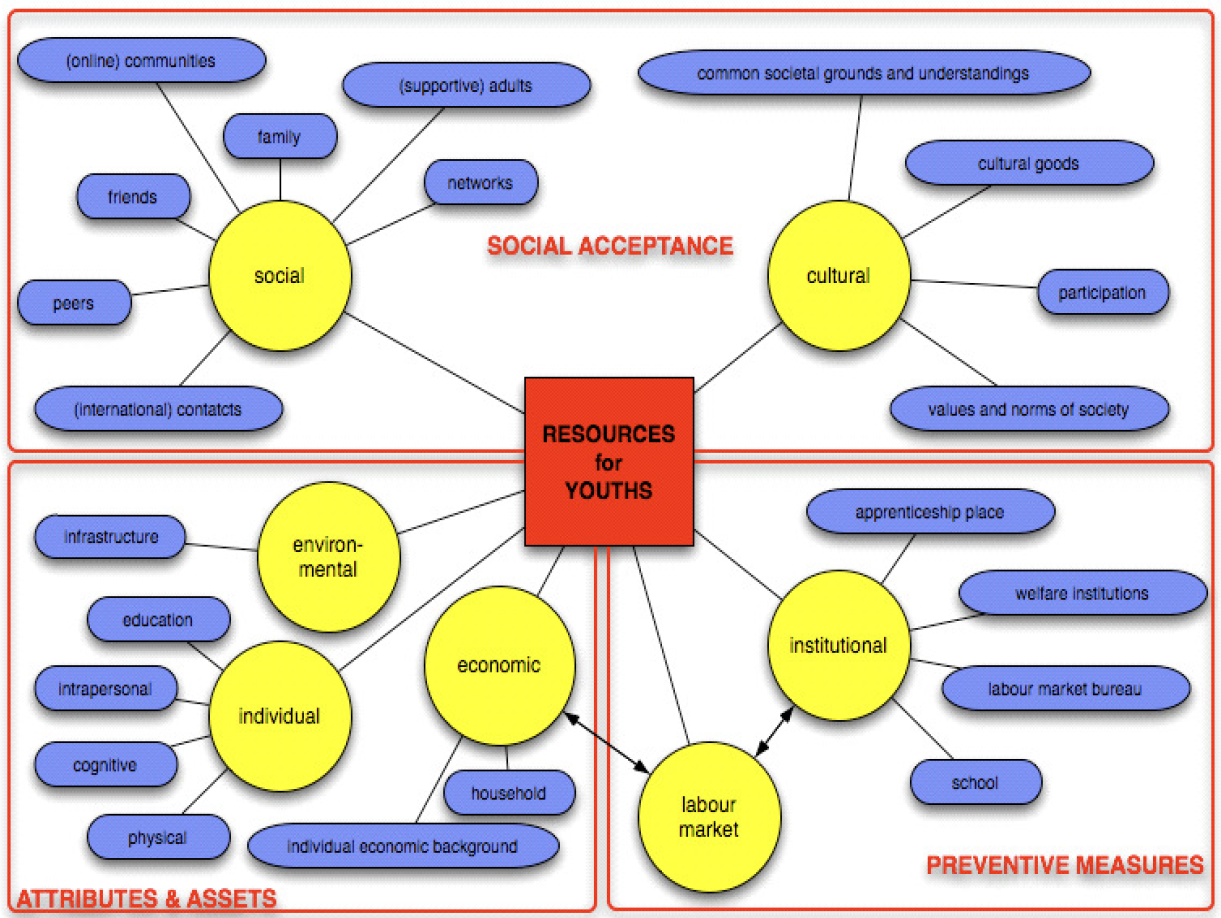
Abbildung 4: ComeIn – Mehrdimensionales Ressourcenmodell (Unterfrauner & Marschalek, 2009, S. 2)
2.2.2.5 „At-risk learners“: Ausgewählte Ansätze zu Risikolernern im internationalen englischsprachigen Kontext
Jugendliche Risikolerner (engl: at-risk learners), die weder eine Schule besuchen noch in Ausbildung oder in einer Anstellung sind, nennt man in Großbritannien, China, Südkorea und Japan NEET: N ot in E ducation, E mployment or T raining. Nach Angaben des britischen Ministeriums für Kinder, Schule und Familie (dcsf.gov.uk) waren das Ende 2007 fast ein Zehntel der 16- bis 18-Jährigen. Um diesem Trend entgegenzuwirken, hat das Ministerium das „NEET strategy and toolkit” -Programm aufgelegt, das jedem 16-jährigen Schulabgänger nach der 11. Klasse bzw. jedem 17-jährigen, der die 12. Klasse nicht erfolgreich beendet, einen Platz in einer Bildungsinstitution garantiert (Department for Children Schools and Families, 2009). In der Folge wurde neben den NEET die Gruppe der „NET – N ot in E ducation or T raining” eingeführt, bei der die arbeitenden und arbeitslosen Jugendlichen fehlen. Seit dem Start des Programms im September 2007 kann man nun einen deutlichen Rückgang der NET beobachten (von 22,3 % in 2007 zu 20,3 %), jedoch ist der Anteil der NEET bei den 16- bis 18-Jährigen um einen halben Prozentpunkt auf über 10 % gestiegen. Der Grund hierfür ist der um zwei Prozentpunkte gestiegene Anteil der Arbeitslosen, 5 insofern bleibt abzuwarten, ob durch das Programm der Anstieg der NEET in Großbritannien zum Erliegen kommt und die Jugendlichen an den für sie eingerichteten Plätzen in den Bildungsinstitutionen die Distanz zur Schule abbauen können und einen auch in Großbritannien so wichtigen Bildungsabschluss erreichen.
Die Autorinnen des Wiener ComeIn-Projekts verwenden mit ihrem Ansatz der marginalisierten Gruppen den gleichen Ansatz zu Risikolernern. Wie bei den NEET stellen sie diejenige Gruppe Jugendlicher in den Mittelpunkt, die ohne Schulabschluss die Pflichtschulzeit absolviert hat und danach in keiner Bildungsinstitution oder Job untergekommen ist.
Für den US-amerikanischen Bereich fasst Barbara E. Baditoi in ihrer Dissertation den Begriff „at-risk learners“ zusammen (Baditoi, 2005, S. 19f). Dabei kann man aus ihrer Zusammenfassung im Wesentlichen drei verschiedene definitorische Linien herauslesen:
-
„At-risk learners“ bzw. Risikolerner sind Schüler, die den Anforderungen der Schule nicht gerecht werden und daran scheitern. Es sind diejenigen Schüler, die desinteressiert sind, den Unterricht stören und sich dem Lernen verweigern bzw. – allgemeiner – ihr eigenes Potenzial nicht ausschöpfen. Dieser Ansatz ist schülerzentriert und legt die Verantwortung für das Scheitern fast vollständig in die Hände der Schüler (ebenda, S. 19).
-
Der zweite Ansatz zu Risikolernern, den Baditoi herausarbeitet, sind Jugendliche, die sich riskant verhalten. Vor allem Jugendarbeiter verwenden demnach den Begriff „at-risk“, um Jugendliche zu beschreiben, die sich in Bezug auf ihre Gesundheit riskant verhalten und Tabak, Alkohol oder Drogen konsumieren sowie mitunter ein erhöhtes Risiko für Geschlechtskrankheiten haben (ebenda, S. 19).
-
Der dritte Ansatz zu Risikolernern macht eher die Schule bzw. Gesellschaft für das Scheitern einiger Jugendlicher verantwortlich. Hierunter fallen zum einen der soziale Status und wahrscheinlich die ethnische Zugehörigkeit. Dieser Ansatz entspricht somit der oben skizzierten sozialen Benachteiligung und Ungleichheit. Die Schule selbst trage aber laut Baditoi ebenfalls die Verantwortung für Risikolerner, indem Erwachsene diese Jugendlichen dem Risiko aussetzten. So erfahren die Risikolerner eine Inkongruenz zwischen ihren Umständen und ihren Bedürfnissen bzw. die mangelnde Fähigkeit oder den mangelnden Willen der Schule, die Kompetenzen der Schüler anzuerkennen und zu fördern (ebenda, S. 19).
Insgesamt ergibt sich daraus ein Konzept der Risikolerner, das zum britischen Ansatz der NEET bzw. zum US-amerikanischen Ansatz der „at-risk learners“ sehr anschlussfähig ist. Dabei stehen die strukturelle und gesellschaftliche Dimension für die Identifikation von Risikolernern für diese Arbeit weiterhin im Vordergrund.
2.2.2.6 Exkurs: Sozio-ökonomische Klassen als Instrument der PISA-Studien, „Benachteiligung“ zu operationalisieren
Die PISA-Studien (Programme for International Student Assessment) zur Schulleistungsmessung der OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) verwenden im Wesentlichen zwei unterschiedliche Systeme der Sozialstrukturanalyse, um damit soziale Lagen zu beschreiben und soziale Ungleichheit oder Benachteiligung zu operationalisieren. Die Erhebungswelle 2000 hatte den Schwerpunkt „Leseliteralität“ im Sinne der Fähigkeit, geschriebene und bebilderte, kontinuierliche und diskontinuierliche Texte zu verstehen und zu nutzen, um aktiv an Gesellschaft teilzunehmen. In dieser Studie dienen EGP-Klassen dazu, soziale Schichtung im Sinne von oberer bis unterer sozialer Klasse auf einer vertikalen Achse zu beschreiben. Die EGP-Klassen gehen zurück auf Erikson, Goldthorpe und Portocarero (1979) und beruhen auf einer vertikalen Klassifikation von Berufen. Sie sind absteigend nach sozialem Ansehen von Berufen, Stellung im Beruf, dem Ausmaß der Weisungsbefugnisse und dem zu erwartendem Einkommen geordnet (Artelt, Stanat, Schneider, & Schiefele, 2001, S. 338). Hieraus entsteht eine sechsgliedrige vertikale Skala. An oberste Stelle steht die Obere Dienstklasse mit Akademikern, höheren Beamten sowie Hochschul- und Gymnasiallehrern. An zweiter Stelle ist die Untere Dienstklasse, die durch ein geringeres Ausmaß an „Macht, Verantwortung und Autonomie“ (ebenda, S. 339) als die Obere Dienstklasse gekennzeichnet ist. Die mittleren beiden Dienstklassen sind von „Routinedienstleistungen in Handel und Verwaltung“ (ebenda) und von Selbstständigen und Landwirten geprägt. Die unteren beiden Dienstklassen sind „Facharbeiter und Arbeiter mit Leitungsfunktion“ sowie „Un- und angelernte Arbeiter sowie Landarbeiter“ (ebenda). Hierbei gibt es deutliche Zusammenhänge zwischen der Klassenzugehörigkeit der Eltern und dem eingeschlagenen Bildungsgang sowie der Leseleistung: Je höher die EPG-Klasse, umso höher die Bildungsbeteiligung an Gymnasium bzw. umso niedriger die Beteiligung an Hauptschule. Gleiches gilt für die mittlere Lesekompetenz. Auch hier ist die schlechteste Leseleistung bei Jugendlichen der Klasse der „Un- und angelernten Arbeiter sowie Landarbeiter“. Nach diesem System sind also die Kinder der unteren EGP-Klassen die Gruppe der Risikolerner.
Die Erhebungswellen 2003, mit Schwerpunkt Mathematik und Problemlösen, und 2006, mit Schwerpunkt Naturwissenschaften und zusätzlich motivationalen Orientierungen und Einstellungen gegenüber den Naturwissenschaften, verwendeten das System PISA Index of Economic, Social and Cultural Status (ESCS). Der ESCS ist wie die EGP-Klassen ein skaliertes, vertikales, eindimensionales Achsensystem. Mit dem ESCS wurde versucht, neben der hauptsächlich ökonomischen Ausstattung der Haushalte und dem sozialen Ansehen des Berufes des Haushaltshauptverdieners, wie sie in den EPG-Klassen abgebildet sind, auch kulturelle Ressourcen in den Familien und Haushalten, in denen Jugendliche aufwachsen, abzubilden. Mit Bezug auf das Konzept des kulturellen Kapitals von Pierre Bourdieu (vgl. 1987) verstehen Timo Ehmke und Thilo Siegle unter kulturellen Ressourcen „Kunstwerke oder Literatur (objektiviert)“ (Ehmke & Siegle, 2005, S. 523), den „Besitz von Bildungszertifikaten (institutionalisiert) und von körpergebundenen und sozialisationsbedingten Dispositionen wie Kompetenzen, Wertorientierungen und Einstellungen (inkorporiert)“ (ebenda). Im internationalen Vergleich hat sich hierbei gezeigt, dass es gerade in Deutschland deutliche Zusammenhänge zwischen dem sozioökonomisch-kulturellen Index, den Schulleistungen und dem Bildungsgang, also den Schularten, gibt. Im internationalen Vergleich ist dieser Zusammenhang in Deutschland – nach Bulgarien – am zweitstärksten (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007a, S. 37). Stark begünstigt wird dieser Zusammenhang in Ländern, in denen Schüler früh innerhalb der Sekundarstufe auf unterschiedliche Schularten aufgeteilt werden, wie z. B. in Deutschland (ebenda, S. 8). Die Relevanz von Hauptschule als Risikoschule ist deutlich. Kommen ein niedriger (zumindest) ökonomischer Status und die Schulart Hauptschule zusammen, begünstigt dies Misserfolge in der Bildungskarriere.
2.3 Ausgangspunkt: Risikolerner in den PISA-Studien
Das folgende Kapitel widmet sich den Risikolernern in eher bildungssoziologischer Perspektive. Das Ergebnis der vorangegangenen Kapitel für Risikolerner ist, dass Schulzugehörigkeit und soziale Lage bzw. soziale Ungleichheit eng miteinander verknüpft sind. Mit diesem zentralen Zwischenergebnis ist auch festgelegt, dass „Risikolerner“ weniger als Phänomen einzelner Schüler gesehen werden kann, sondern als gesellschaftliches Phänomen behandelt werden muss. Dementsprechend und ausgehend von den eingangs grob erwähnten Ergebnissen der PISA-Studien erörtert der folgende Abschnitt die Risikogruppen, die die drei PISA-Erhebungen aufgedeckt haben. Dies wird zuvor von allgemeinen Daten zur Bevölkerung und zur Bildungsbeteiligung in Deutschland gerahmt.
2.3.1 Bildungsbeteiligung in Deutschland allgemein
2.3.1.1 Bildungsbeteiligung in Deutschland
Das Statistische Bundesamt verzeichnet für Deutschland im Jahr 2007 eine Gesamtbevölkerung von 82.217.837 Menschen, davon sind 19,4 % jünger als 20 Jahre. 6 In Zahlen sind das etwa 15.950.260 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Allgemeinbildende und berufliche Schulen besuchten im Schuljahr 2007/2008 9.183.811 bzw. im folgenden Schuljahr 9.014.578 Schüler. 7 Der Bildungsbericht 2008 gibt für das Schuljahr 2005/2006 an, dass 7.717.091 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren eine allgemeinbildende oder berufliche Schule besuchten (Autorengruppe „Bildungsberichterstattung“, 2008, S. 230), davon besuchten ca. 6,6 Mio. allgemeinbildende Schulen. Dieser Wert sank bis zum Jahr 2008/2009 auf ca. 5,8 Mio. Schüler. 8 Die eigene Auswertung des Jahres 2008/2009 ergab für die – für Risikolerner relevante – Hauptschule eine Bildungsbeteiligung von 14 %, wobei angemerkt sei, dass die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen keine Hauptschulen haben (vgl. ebenda, S. 62). Im Vergleich zu anderen Bundesländern sind hier die Hauptschüler implizit in den Zahlen der integrierten Gesamtschulen und in den Schularten mit mehreren Bildungsgängen enthalten. Außer für Mecklenburg-Vorpommern gilt dies auch im Fall der Realschulen. Wenngleich die Hauptschule in Bayern und Baden-Württemberg eine hohe Relevanz hat, sind die Schülerzahlen an der Hauptschule in den letzten 20 Jahren stark zurückgegangen (ebenda). Mit Verweis auf die PISA-Studie aus dem Jahr 2000 bemängelt der Bildungsbericht 2008, „dass bundesweit etwa jede fünfte Hauptschule in sehr problematischen Lernkontexten arbeitet, die durch einen sehr hohen Anteil an Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Verbindung mit niedrigem sozialen Status der Schüler, häufigen Lernschwierigkeiten und Verhaltensproblemen gekennzeichnet sind“ (ebenda, S. 62). Weiterhin berichten die Autoren, dass „sogar 65% der Hauptschulen zu den sogenannten belasteten Schulen“ (ebenda) gehören und dass die Hauptschule in der öffentlichen Diskussion eine „Entwicklung zur ‚Problemschule’“ erlebe (ebenda).
 Abbildung 5: Bildungsbeteiligung Jugendlicher an allgemeinbildenden Schulen 2008/2009 nach Geschlecht (eigene Auswertung)
Abbildung 5: Bildungsbeteiligung Jugendlicher an allgemeinbildenden Schulen 2008/2009 nach Geschlecht (eigene Auswertung)
Die Verteilung der Geschlechter nach Schularten im Jahr 2008/2009 offenbart eine recht deutliche Mehrheit der Jungen an den Hauptschulen, wohingegen die Jungen an den Gymnasien in der Minderheit sind. Besonders stark fällt der Geschlechterunterschied an den Sonderschulen aus, wo fast zwei Drittel der Schüler Jungen sind.
2.3.1.2 Wiederholer und Schulwechsler als Risikolerner
Zum Feld der Risikolerner bzw. zum Feld derjenigen, die vom Risiko betroffen sind, aus dem Schulsystem zu fallen, sind sicherlich Schüler hinzuzuzählen, die Jahrgänge wiederholen müssen bzw. die Schulart wechseln müssen. Hierzu berichtet der Bildungsbericht 2008, dass im Schuljahr 2006/2007 mit etwa 234.000 SchülerInnen 2,7 % aller Schüler von der Grundschule bis zum Sekundarbereich II eine Jahrgangsstufe wiederholten (Autorengruppe „Bildungsberichterstattung“, 2008, S. 69). Im innerdeutschen Ländervergleich hat Bayern mit 3,8 % aller Schüler und in Bezug auf die Sekundarstufe I (5. bis 10. Klasse) mit sogar fast 6 % aller Schüler die höchste Quote an Klassenwiederholungen (ebenda). Das bedeutet, dass in Bayern pro Schulklasse ein bis zwei Schüler pro Jahr durchfallen, weil sie das Klassenziel nicht erreichen. Das bedeutet auch, dass in jeder Klasse etwa ein bis zwei Wiederholer sitzen.
Für den genaueren Blick auf die Schularten weist der Bildungsbericht darauf hin, „dass ein Teil der wiederholenden Schülerinnen und Schüler die Schulart wechselt und damit als Wiederholer an der aufnehmenden Schulart geführt wird.Die Realschulen weisen daher mit über 5 % die höchsten Wiederholerquoten auf“ (ebenda, S. 70).
In Bezug auf Geschlechter gibt der Bildungsbericht 2008 deutlich an, dass Jungen nach der Grundschule häufiger als Mädchen einmal oder mehrmals eine Jahrgangsstufe wiederholen. Dieses Gefälle ist im Vergleich zu 1995/1996 gleich geblieben (ebenda).
Als Fazit kann man hieraus für Risikolerner festhalten, dass es, abgesehen vom regionalen Unterschied, nur die Jungen gibt, die als Wiederholer auffällig sind. Der Bildungsbericht 2008 macht ansonsten keine Angaben, die sozialstrukturanalytisch verwertbar sind.
Im Bildungsbericht 2006 finden sich genauere Informationen bezüglich Schulwechsel bzw. „Auf- und Abwärtsmobilität“ im Sekundarbereich I (Autorengruppe „Bildungsberichterstattung“, 2006, S. 51f).
 Abbildung 6: Auf- und Abwärtsmobilität in West- und Ostdeutschland für die Jahrgangsstufen 7 bis 9 (2004/05, in % aller Wechsel (Autorengruppe „Bildungsberichterstattung“, 2006, S. 52)
Abbildung 6: Auf- und Abwärtsmobilität in West- und Ostdeutschland für die Jahrgangsstufen 7 bis 9 (2004/05, in % aller Wechsel (Autorengruppe „Bildungsberichterstattung“, 2006, S. 52)
Die Grafik macht deutlich, dass es in den alten Bundesländern eine hohe Zahl an Schülern gibt, die vom Gymnasium in die Realschule bzw. von der Realschule in die Hauptschule wechseln. Dem gegenüber steht eine vergleichsweise geringe Zahl an Schülern, die in den alten Bundesländern den Aufstieg von der Haupt- in die Realschule schaffen. In Zahlen bedeutet das, dass auf 11 Schüler, die vom Gymnasium in die Realschule absteigen, lediglich ein Schüler oder eine Schülerin kommt, der bzw. die den umgekehrten Aufstieg schafft.
Bemerkenswert dagegen ist die große Zahl der Schüler in den neuen Bundesländern, die den Sprung von Schulen mit mehreren Bildungsgängen (Gesamtschulen) an das Gymnasium schaffen. Und ebenfalls bemerkenswert ist auch, dass der Aufstieg von der Hauptschule in die Realschule zwar sicherlich schwierig, aber durchaus möglich ist. Dies verdeutlichen die 16,1 % aller Schulwechsler im Jahr 2004/2005, denen dieser Kraftakt gelungen ist.
Festzuhalten bleibt, dass ein Schulwechsel ein hohes Risiko bedeutet, im Bildungssystem abzusteigen. Kombiniert mit den Ergebnissen des Bildungsberichts 2008 muss man vermuten, dass hauptsächlich die Jungen im Bildungssystem absteigen und damit schlechter qualifiziert ihre Schulzeit beenden und ins Berufsleben eintreten.
2.3.2 Ergebnisse der einzelnen PISA-Studien zu Risikolernern
Die Risikolerner, die die PISA Studien identifiziert haben, sind einer der zentralen Ausgangspunkte dieser Arbeit und speziell für die Identifikation genauerer Gruppen unter den Jugendlichen bedeutsam. Dementsprechend gibt der folgende Abschnitt die zentralen Ergebnisse der jeweiligen Erhebungswellen der Jahre 2000, 2003 und 2006 zu den Themen Lesekompetenz, mathematische Grundbildung und naturwissenschaftliche Grundbildung und Problemlösefähigkeit in Bezug auf Risikolerner wieder.
2.3.2.1 Überblick zu den Kompetenzstufen der jeweiligen Erhebungen
In den PISA-Studien wurden die untersuchten Leistungen für das Jahr 2000 jeweils in fünf Kompetenzstufen eingeteilt, wobei Schüler die ausreichenden Basiskompetenzen jeweils mit erfolgreichem Erfüllen der Kompetenzstufe 2 erreichen. Die Basiskompetenz Stufe 2 umfasste in der Erhebung zur Lesekompetenz (2000) folgende drei Dimensionen bzw. Sub-Skalen und damit verbundene Anforderungen:
-
Dimension „Informationen ermitteln“: „Eine oder mehrere Informationen zu lokalisieren, die beispielsweise aus dem Text geschlussfolgert werden müssen und die mehrere Voraussetzungen erfüllen müssen. Die Auswahl wird durch einige konkurrierende Informationen erschwert.“ (Deutsches PISA-Konsortium, 2001b, S. 89)
-
Dimension „Textbezogenes interpretieren“: „z.B. das Erkennen eines wenig auffallend formulierten Hauptgedankens eines Textes. Andere Aufgaben erfordern das Verstehen von Beziehungen oder das Erfassen einer Beziehung innerhalb eines Textteils auf der Basis von einfachen Schlussfolgerungen. Aufgaben auf diesem Niveau, die analoges Denken beinhalten, erfordern üblicherweise Vergleiche oder Kontraste, die auf nur einem Merkmal des Textes basieren.“ (ebenda)
-
Dimension „reflektieren und bewerten“ : „z.B. einen Vergleich von mehreren Verbindungen zwischen dem Text und über den Text hinausgehendem Wissen. Bei anderen Aufgaben müssen Leser auf ihre persönlichen Erfahrungen und Einstellungen Bezug nehmen, um bestimmte Merkmale des Textes zu erklären. Die Aufgaben erfordern ein breites Textverständnis.“ (ebenda)
In der Studie wird Lesekompetenz damit definiert, „geschriebene Texte zu verstehen, zu nutzen und über sie zu reflektieren, um eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen und Potenzial weiterzuentwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“ (ebenda, S. 23). Die Schüler mussten dazu in verschiedenen Aufgaben unterschiedliche Arten von Texten und Dokumenten lesen, Informationen heraussuchen, Interpretationen entwickeln und über Texte reflektieren.
Die Basiskompetenz Stufe 2 von 6 umfasste in der Erhebung zur mathematischen Grundbildung (2003) folgende Dimensionen bzw. Sub-Skalen und damit verbundene Anforderungen:
-
Dimension „Raum und Form“. In dieser Dimension mussten die Schüler „Probleme unter Verwendung einer einzigen mathematischen Darstellung lösen, in der der mathematische Inhalt direkt und klar dargelegt ist; grundlegende mathematische Überlegungen und Regeln in vertrauten Kontexten“ anwenden (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development, 2004, S. 63).
-
Dimension „Veränderung und Beziehungen lösen“: In dieser Dimension sollten Schüler zur „Lösung von Problemen mit einfachen Algorithmen, Formeln und Verfahren arbeiten; einen Text mit einer einzigen Darstellung (einem Graph, einer Tabelle, einer einfachen Formel) in Zusammenhang bringen; auf elementarem Niveau die Fähigkeit zu Interpretation und mathematischem Denken einsetzen“ (ebenda, S. 78).
-
Dimension „quantitatives Denken“: In dieser Dimension sollten Schüler einfache „Tabellen interpretieren, um relevante Informationen zu identifizieren und zu entnehmen; grundlegende arithmetische Rechnungen durchführen; einfache quantitative Beziehungen interpretieren und damit arbeiten“ (ebenda, S. 88).
-
Dimension „Unsicherheit lösen“: In dieser Dimension sollten die Schüler in „vertrauter graphischer Darstellung gelieferte statistische Informationen auffinden; grundlegende statistische Konzepte und Regeln verstehen“ (ebenda, S. 96).
Um die Basiskompetenz der Stufe 2 von 6 zu erreichen, mussten Schüler in der Lage sein, Situationen in Kontexten zu interpretieren und zu erkennen, die einen direkten Zugriff gestatten. Schüler sollten in der Lage sein, relevante Informationen einer einzigen Quelle zu entnehmen und eine einzige Darstellungsform zu benutzen. „Schüler auf dieser Stufe können elementare Algorithmen, Formeln, Verfahren oder Regeln anwenden. Sie sind zu direkten Schlussfolgerungen und wörtlichen Interpretationen der Ergebnisse imstande.“ (ebenda, S. 53)
In der Studie wird mathematische Grundbildung definiert mit der „Fähigkeit einer Person, die Rolle zu erkennen und zu verstehen, die Mathematik in der Welt spielt, fundierte Urteile abzugeben und die Mathematik zu nutzen und sich mit ihr in einer Weise zu befassen, die den Anforderungen im Leben dieser Person als konstruktivem, engagiertem und reflektierendem Bürger entspricht“ (ebenda, S. 27). In der PISA-Studie 2003 wurde erstmals die fächerübergreifende Kompetenz „Problemlösen“ untersucht (ebenda, S. 31).
Die Basiskompetenz Stufe 2 von 6 umfasste in der Erhebung zur naturwissenschaftlichen Grundbildung (2006) folgende Dimensionen bzw. Sub-Skalen und damit verbundene Anforderungen:
-
Dimension „Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen“: Um diese Kompetenzstufe zu erreichen, sollten Schüler „beurteilen, ob sich eine gegebene Variable in einer Untersuchung für eine naturwissenschaftliche Messung anbietet. Sie können die Variable erkennen, die vom Untersuchenden manipuliert (verändert) wird. Sie können den Zusammenhang zwischen einem einfachen Modell und dem mit ihm dargestellten Phänomen erkennen. Sie können geeignete Schlüsselbegriffe für eine thematische Suche identifizieren“ (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007b, S. 91).
-
Dimension: „Phänomene naturwissenschaftlich erklären“: Zur Erreichung dieser Kompetenzstufe mussten sich Schüler „an einen sachdienlichen, konkreten naturwissenschaftlichen Sachverhalt erinnern, der in einem einfachen, klaren Kontext Anwendung findet, und ihn zur Erklärung oder Vorhersage eines Ergebnisses heranziehen“ (ebenda, S. 101).
-
Dimension „Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen“: „Auf dieser Stufe sind Schüler in der Lage, allgemeine Merkmale einer Grafik zu erkennen, wenn sie geeignete Hinweise erhalten, und können auf ein offensichtliches Merkmal in einer Grafik oder einer einfachen Tabelle hinweisen, das eine bestimmte Behauptung bestätigt. Sie können erkennen, ob eine Gruppe vorgegebener Merkmale auf die Funktionen alltäglicher Gebrauchsgegenstände zutrifft, um so Entscheidungen über ihre Verwendung zu treffen“ (ebenda, S. 118).
Allgemein formuliert die OECD für die Basiskompetenzstufe 2 von 6, dass „Schüler im Allgemeinen über genügend naturwissenschaftliches Wissen“ verfügen, „um mögliche Erklärungen in vertrauten Kontexten zu liefern oder ausgehend von einfachen Untersuchungen Schlüsse zu ziehen. Sie können direkte logische Denkschritte vollziehen und die Ergebnisse naturwissenschaftlicher Untersuchungen oder technologischer Problemlösungen wörtlich interpretieren“ (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007a, S. 15). Allgemein ist naturwissenschaftliche Grundbildung in dieser Studie definiert „als der Umfang, in dem eine Person:
-
naturwissenschaftliches Wissen besitzt und dieses Wissen anwendet, um Fragestellungen zu identifizieren, neue Kenntnisse zu erwerben, naturwissenschaftliche Phänomene zu erklären und aus Beweisen Schlussfolgerungen in Bezug auf naturwissenschaftliche Sachverhalte zu ziehen;
-
die charakteristischen Eigenschaften der Naturwissenschaften als eine Form menschlichen Wissens und Forschens versteht;
-
erkennt, wie Naturwissenschaften und Technologie unsere materielle, intellektuelle und kulturelle Umgebung prägen;
-
sich mit naturwissenschaftlichen Themen und Ideen als reflektierender Bürger auseinandersetzt“. (ebenda, S. 13)
In der Langfassung dieser Definition heben die Autoren zusätzlich die Wichtigkeit hervor, wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche Aspekte eines Textes unterscheiden zu können bzw. differenzieren zu können, ob Aspekte eines Textes auf Beweisen basieren oder Teil persönlicher Meinungsäußerung sind (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007b, S. 41).
2.3.2.2 Die Risikogruppen in der PISA-Erhebung 2000
Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse der ersten der drei PISA-Studien im April 2001 waren in Deutschland die Überraschung und das Entsetzen über das vergleichsweise schlechte Abschneiden der deutschen Schüler spürbar. Demnach hatten fast 10 % der damals 15-jährigen Schüler noch nicht einmal die Kompetenzstufe 1 geschafft, und Deutschland lag damit im internationalen Vergleich nur knapp vor den Ländern Brasilien, Mexiko, Lettland und Luxemburg (Artelt, Baumert, u. a., 2001, S. 16). Weitere 13 % der Schüler in Deutschland erreichten gerade einmal die erste Kompetenzstufe, sodass insgesamt ca. 23 % der Schüler nicht die erforderliche Basiskompetenzstufe 2 erreichten (ebenda). Besonders bei Aufgaben, „die das Reflektieren und Bewerten von Texten erfordern“ (ebenda), haben die deutschen Schüler Schwierigkeiten. Auffällig dabei sei, so schreiben die Autoren, dass es in Deutschland einen erkennbaren Zusammenhang zwischen der mit Lesen verbrachten Freizeit und den im Test erzielten Leseleistungen gebe. Dies bedeutet, dass Schüler mit schlechten Leseleistungen deutlich weniger in ihrer Freizeit lesen als Schüler mit guten Ergebnissen. In Zahlen bedeutet dies, dass Deutschland mit 42 % das schlechteste Ergebnis bei der Frage erzielte, ob Schüler zum Vergnügen lesen.
Die PISA-Studien haben zur Ermittlung der sozioökonomischen und soziokulturellen Verhältnisse der Schüler die berufliche Stellung und den Bildungsgrad der Eltern abgefragt (siehe Kapitel ). Dabei stellte sich heraus, dass gerade in Deutschland ein massiver Zusammenhang zwischen der beruflichen Stellung der Eltern und den Leseleistungen der Schüler besteht (Artelt, Stanat, u. a., 2001, S. 387). So erzielen in Deutschland Schüler, deren Eltern den niedrigsten beruflichen Status haben, ähnliche Ergebnisse in der Leseleistung wie die durchschnittliche Leseleistung der Schüler in Mexiko, dem Land mit der größten Leistungsschwäche in PISA 2000 (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development, 2001, S. 164). Dabei betonen die Autoren, wenngleich die berufliche Stellung nicht automatisch ein Bedingungsfaktor für Schulleistungen sei, so ist doch für Deutschland gesehen ein höherer sozioökonomischer Status ein erheblicher Leistungsvorteil. Ähnliches gilt auch für das im Haushalt frei verfügbare Einkommen, das Schülern einen Vorteil verschafft, wenngleich dieser Effekt in Deutschland nicht so stark ausgeprägt ist wie jener der beruflichen Stellung (ebenda, S. 168).
Ein weiterer gravierender Zusammenhang besteht zwischen dem Bildungsabschluss der Mütter und den Schulleistungen der Schüler. Im internationalen Vergleich ist dieser Zusammenhang in Deutschland am ausgeprägtesten und bedeutet konkret, dass für Schülerinnen und Schüler, deren Mütter nicht die Sekundarstufe II (Haupt- oder Realschule) abgeschlossen haben, „eine 2,1 bis 3-mal so hohe Wahrscheinlichkeit“ besteht, „Leistungen im unteren Quartil der Schülerpopulation zu erzielen, als für Schülerinnen oder Schüler deren Mütter die Sekundarstufe II abgeschlossen haben“ (ebenda, S. 175).
Für Jugendliche mit Migrationshintergrund hat die PISA-Studie 2000 ebenfalls deutlich schwächere Leseleistungen und damit Schulleistungen festgestellt. In den PISA-Studien wurde der Migrationshintergrund in drei Kategorien eingeteilt:
-
Schüler, von denen wenigstens ein Elternteil nicht im Erhebungsland (in diesem Fall Deutschland) geboren wurde.
-
Schüler, die selbst im Erhebungsland geboren wurden, jedoch kein Elternteil im Erhebungsland zur Welt kam.
-
Schüler und Eltern, die nicht im Erhebungsland geboren wurden. (Artelt, Stanat, u. a., 2001, S. 378)
In Bezug auf die Leseleistung der Schüler aus Migrationsfamilien zeigte sich, dass soziale Lage oder die mögliche kulturelle Distanz der Familien keinen Einfluss auf die mindere Leistung der Schüler haben. Vielmehr spielt die Sprache, die in den Familien gesprochen wird, die entscheidende Rolle. So hatten Schüler, deren Eltern in Deutschland geboren wurden, kaum schlechtere Ergebnisse als die mittlere Leistung der Population (ebenda, S. 379). Wenn aber eines der Elternteile oder beide Eltern nicht in Deutschland geboren wurden, sinken die Ergebnisse im Leistungstest erheblich. So erreichen fast 50 % der Schüler, deren Eltern nicht in Deutschland geboren wurden, nicht die Kompetenzstufe I und zählen somit zum „Anteil extrem schwacher Leser“ (ebenda, S. 379). Die OECD macht daher in diesem Zusammenhang deutlich, dass für „Schüler in Belgien, Deutschland, Luxemburg und der Schweiz, die zu Hause nicht die Testsprache oder eine andere offizielle Landessprache bzw. einen nationalen Dialekt sprechen, die Wahrscheinlichkeit zumindest zweieinhalbmal so hoch ist, zu den leistungsschwächsten 25% der Schülerinnen und Schüler im Bereich Lesekompetenz zu gehören“ (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development, 2001, S. 183).
Die bislang häufig erwähnte Hauptschule wird in den internationalen Berichten der OECD nicht erwähnt. Sie ist daher ein für Deutschland nationales Thema. Wie bereits erwähnt, sind in einigen Bundesländern die Haupt- und Realschulen in Gesamtschulen aufgegangen und Baumert und Weiß machen daher darauf aufmerksam, dass eine Vergleichbarkeit der Leistungen der Schüler in Bezug auf die Hauptschule für Gesamtdeutschland schwierig ist. Des Weiteren rechnen sie für die Bundesländer mit Hauptschule die berufliche Ausbildung zur Hauptschulzeit dazu, wodurch sich mit 30 % bis 42 % eine relativ hohe Bildungsbeteiligung ergibt (Baumert & Weiß, 2002, S. 50f).
In Bezug auf die Leseleistung hat die PISA-Studie 2000 für die Hauptschüler erhebliche Schwächen aufgezeigt. Knapp 43 % der Hauptschüler erreichen nicht die Basiskompetenzstufe II, und sogar 25 % „sind nicht in der Lage, die Aufgaben der niedrigsten Kompetenzstufe zu lösen“ (Artelt, Stanat, u. a., 2001, S. 127). Die Leseleistung der Schüler der integrierten Gesamtschulen ist ebenfalls weit unter dem internationalen Durchschnitt, und es ist erkennbar, dass in diesen Schulen – vor allem in den neuen Bundesländern – die Haupt- und Realschulen zusammengefasst sind, da deren Leistungsspektrum und Leistungsheterogenität im Vergleich zu den anderen Schularten am größten ist (Baumert, Trautwein, & Artelt, 2003, S. 296; Stanat & Kunter, 2001, S. 371). Verbindet man diese Ergebnisse mit der sozioökonomischen Lage der Eltern, ergibt sich ein differenzierteres Bild. So macht die PISA-Studie einerseits deutlich, dass Schüler aus statusniedrigeren Familien schlechtere Leseleistungen erzielen, und verdeutlicht andererseits, dass die Schüler an den Hauptschulen aus statusniedrigeren Familien stammen. Dies lässt aber nicht den Schluss zu, dass Hauptschüler per se schlechtere Leseleistungen erzielen.

Abbildung 7: 15-Jährige nach Sozialschichtzugehörigkeit und Bildungsgang (Baumert & Schümer, 2001, S. 355)
Die folgende Grafik der Leistungsverteilung nach Sozialschichten zeigt, dass die Leseleistungen der unteren Schicht (Un- und angelernte Facharbeiter) durchaus mit den Leistungen der EGP-Klasse III überlappt und die Leistungen der oberen Dienstklasse hineinreicht (Baumert & Schümer, 2001, S. 362). Ähnliches gilt für den Zusammenhang zwischen Leseleistung und Schulart, der zeigt, dass durchaus einige Hauptschüler mit dem Leistungsniveau der Gymnasiasten mithalten (Baumert u. a., 2003, S. 298; Baumert & Weiß, 2002, S. 51).
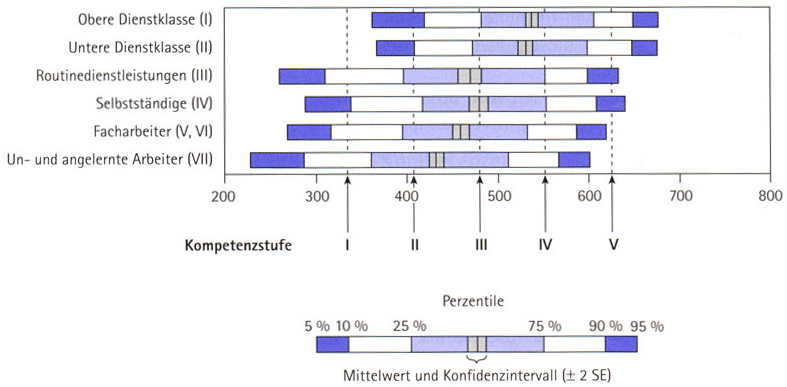
Abbildung 8: Verteilung der Lesekompetenz innerhalb der Sozialschichten (Baumert & Schümer, 2001, S. 362)
Der vermutlich entscheidende Kern für den Zusammenhang zwischen Leseleistungen bzw. Schulleistungen, Schulart und sozioökonomischem Status bzw. Migrationshintergrund ist das ungünstige Zusammentreffen benachteiligender Faktoren in der Hauptschule (Baumert & Weiß, 2002, S. 51). Anders ausgedrückt, bedeutet dies eine bestimmte Heterogenität der Hauptschüler in Bezug auf Schulleistungen. So ist das Gymnasium die Schulart mit der größten Heterogenität in Bezug auf die sozioökonomische Lage, aber am homogensten in Bezug auf die Schulleistungen der Schüler. Umgekehrt verhält es sich für die integrierten Gesamtschulen und Hauptschulen. Diese Schulen weisen Homogenität in Bezug auf die soziale Lage der Schüler auf, die Schüler selbst jedoch zeigen ein breites, heterogenes Leistungsspektrum (Stanat & Kunter, 2001, S. 371).
Die PISA-Studie 2000 hat in Bezug auf die Leseleistungen große geschlechterspezifische Unterschiede festgestellt. So haben allgemein Mädchen die besseren Leseleistungen erzielt (Stanat & Kunter, 2001, S. 255). Betrachtet man die geschlechterspezifischen Leseleistungen für die verschiedenen Schularten, weisen die Autoren für die Hauptschule und die integrierte Gesamtschule keinen statistisch signifikanten Unterschied aus, obwohl Mädchen an diesen Schulen dennoch die besseren Leistungen erzielen (ebenda, 260). In Bezug auf die drei Dimensionen der Lesekompetenz (Informationen heraussuchen, textbezogenes Interpretieren, Reflektieren und Bewerten) haben die Mädchen in der Dimension „Informationen heraussuchen“ nur geringfügig bessere Leseleistungen als die Jungen bzw. ist der Abstand zwischen den Leistungen der Jungen und Mädchen am geringsten. Auffällig ist, dass Jungen in Bezug auf nicht-kontinuierliche Texte in allen Schulformen außer der integrierten Gesamtschule sogar etwas bessere Leseleistungen erzielen als Mädchen (ebenda). Die Ergebnisse zur Leseleistung stehen im Zusammenhang mit der unterschiedlichen Motivation der Jungen und Mädchen zum Lesen in der Freizeit. Dementsprechend geben Mädchen in allen Teilnehmerländern wesentlich häufiger als Jungen an, dass Lesen eines ihrer liebsten Hobbys sei. Für Deutschland fällt jedoch der Wert der Jungen, die Lesen als ihr liebstes Hobby angeben, weit niedriger als der OECD-Durchschnitt aus (ebenda, S. 263). Umgedreht ist der Wert der Jungen mit 51 % besonders hoch in Bezug auf die Frage, wie genau die Aussage „Ich lese nur, wenn ich muss“ für sie zutrifft (ebenda, S. 262). Die geschlechterspezifischen Unterschiede liegen aber auch in der Art der Texte, die sie in ihrer Freizeit lesen. Demnach lesen im internationalen Durchschnitt Jungen mehr Tageszeitungen als Mädchen (68 % Jungen – 60 % Mädchen), Jungen lesen häufiger Comics (um 11 % mehr als Mädchen) sowie E-Mails und Webseiten (um 10 % mehr als Mädchen) (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development, 2001, S. 156). Diese Lesepräferenz könnte in Zusammenhang mit der leichten Stärke der Jungen im Lesen nicht-kontinuierlicher Texte stehen, da die Lesepräferenzen der Mädchen bei den kontinuierlichen Textformen Romane, Erzählungen und Geschichten mit einem Unterschied von 18 % deutlich höher sind als bei den Jungen.
2.3.2.3 Die Risikogruppen in der PISA-Erhebung 2003
Die durchschnittlichen Ergebnisse der 15-jährigen Schüler der PISA-Studie 2003 in Deutschland zur mathematischen Grundbildung bewegen sich im internationalen Durchschnitt. Die PISA-Studie 2003 identifiziert etwa 9 % der Schüler, die nicht die unterste Kompetenzstufe I erreichen, und insgesamt 21,6 %, die die Basiskompetenzstufe II nicht erreichen (Deutsches PISA-Konsortium, 2003, S. 2). Beide Werte liegen aber im OECD-Durchschnitt. Deutschland liegt in der Auswertung zum fächerübergreifenden Problemlösen deutlich über dem OECD-Durchschnitt (Ramm, Walter, Heidemeier, & Prenzel, 2005, S. 126). Auffallend ist dabei, dass die Problemlösekompetenz sogar um 10 Punkte über der durchschnittlichen mathematischen Kompetenz liegt. Dieser Unterschied zeigt sich noch stärker bei leistungsschwächeren Schülern. Dies lässt den Schluss zu, dass leistungsschwächere Schüler Potenziale haben, die in einigen Fächern nicht genutzt bzw. gefördert werden (Ramm u. a., 2005, S. 142).
Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Mathematikleistungen ist in Deutschland ähnlich hoch ausgeprägt wie bereits in der Studie zur Lesekompetenz (Deutsches PISA-Konsortium, 2003, S. 4). Dies bedeutet für die Schüler aus niedrigeren sozioökonomischen Lagen eine höhere Wahrscheinlichkeit, in Mathematik schlecht abzuschneiden. Wesentliche Faktoren dabei sind, wie bei der Lesekompetenz, der berufliche Status und der Bildungsgrad der Eltern (Jungbauer-Gans, 2006, S. 189; OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development, 2004, S. 210). Ein weiterer wesentlicher Faktor ist aber auch die Heterogenität einer Schule in Bezug auf den sozioökonomischen Status der Schüler. So zeigte sich gerade für Deutschland, dass die mathematischen Leistungen der Schüler umso besser sind, je homogener eine Schülerschaft zusammengesetzt ist.
„Unabhängig von ihrem eigenen sozioökonomischen Hintergrund sind Schülerinnen und Schüler in Schulen mit generell hohem sozioökonomischem Hintergrund leistungsstärker als in Schulen mit einem generell unterdurchschnittlichen sozioökonomischen Hintergrund der Schülerschaft.“ (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development, 2004, S. 216)
Wie im Fall der Lesekompetenz ist das Ergebnis in Bezug auf die Schulart Hauptschule deutlich schlechter als an den integrierten Gesamtschulen oder Realschulen bzw. den Gymnasien (vgl. Deutsches PISA-Konsortium, 2005).
Schüler mit Migrationshintergrund schneiden in der mathematischen Grundbildung noch schlechter ab als in der Lesekompetenz. In Zahlen bedeutet das, dass etwa 25 % der Schüler aus der ersten Zuwanderergeneration nicht die Basiskompetenzstufe II erreichen und sogar 40 % der Schüler aus der zweiten Zuwanderergeneration nicht die Basiskompetenzstufe II erreichen (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development, 2006, S. 8f). Dies bedeutet auch, dass Deutschland und Neuseeland die einzigen Länder sind, in denen Schüler der zweiten Zuwanderergeneration schlechtere Ergebnisse erzielen als Schüler der ersten Generation (ebenda, S. 38). Genauer betrachtet, erzielen Schüler, die nur einen Elternteil haben, der nicht in Deutschland geboren wurde, die besten Ergebnisse der Schüler mit Migrationshintergrund (Ramm u. a., 2005, S. 281). Jugendliche, die zugewandert sind, die selbst und deren Eltern also nicht in Deutschland geboren wurden, schneiden am zweitbesten ab (ebenda, S. 282).
Die Bedeutung der zu Hause gesprochenen Sprache ist, ähnlich wie bei der Lesekompetenz, auch für die Leistungen in Mathematik bedeutsam, wenngleich statistisch weniger auffällig (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development, 2006, S. 48). So erzielen Schüler mit Migrationshintergrund, die zu Hause Deutsch sprechen, bessere Ergebnisse als fremdsprachige oder mehrsprachige Schüler (Ramm u. a., 2005, S. 283).
Die PISA-Studie 2003 mit dem Schwerpunkt Mathematik hat zur Beobachtung von Veränderungen in den Kompetenzen in dieser zweiten Erhebung wieder die Lesekompetenz untersucht und dabei gezeigt, dass alle Schularten außer der Hauptschule bessere Ergebnisse erzielten (Deutsches PISA-Konsortium, 2003, S. 4). Jedoch gilt für die Hauptschule auch in der zweiten Erhebung, dass in dieser Schulart überdurchschnittlich viele Risikogruppen zusammenkommen (ebenda, S. 113).
Die geschlechterspezifischen Unterschiede in den Mathematikleistungen sind weniger gravierend als in den Leseleistungen (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development, 2004, S. 109), wobei Jungen etwas bessere Ergebnisse erzielen als die Mädchen (ebenda). Die Jungen, die die Kompetenzstufe I nicht erreichen, liegen mit einem Anteil von 8,9 % nur leicht über dem OECD-Durchschnitt, und der Anteil der Jungen insgesamt, die die Basiskompetenzstufe II nicht schaffen, beträgt etwa 21 % (ebenda, S. 405).
2.3.2.4 Die Risikogruppen in der PISA-Erhebung 2006
In der PISA-Studie 2006 zur naturwissenschaftlichen Grundbildung ist Deutschland im internationalen Vergleich auf Platz 8 und damit vergleichsweise gut gestellt, wobei etwa 15 % der Schüler nicht die Basiskompetenzstufe II erreichen und damit die zentrale Risikogruppe dieser Erhebung sind (Deutsches PISA-Konsortium, 2006, S. 5). Im Unterschied zu den vorangegangenen Studien ist die Streuung der naturwissenschaftlichen Leistung in Deutschland sehr breit, da der Risikogruppe von 15 % ein Anteil von 11,8 % an Schülern in den obersten Kompetenzstufen 5 und 6 gegenübersteht (ebenda).
Der Zusammenhang zwischen der sozioökonomischen Lage und den Schulleistungen ist nach wie vor hoch und benachteiligt deutlich Schüler aus niedrigeren sozioökonomischen Lagen (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007b, S. 216).
Prinzipiell gelten für Schüler mit Migrationshintergrund die gleichen Ergebnisse wie im Fall der mathematischen Grundbildung. So erzielen Schüler, die im Elternhaus Deutsch sprechen, bessere Ergebnisse (Deutsches PISA-Konsortium, 2006, S. 20). Ebenso wie in der vorangegangenen Studie erreichen zugewanderte Schüler bessere Ergebnisse als Schüler der zweiten Generation (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007b, S. 208).
Mit Bezug auf die naturwissenschaftliche Grundbildung und mit Bezug auf die starke Streuung der Schülerleistungen zeigt sich für die Hauptschule in Deutschland ein problematisches Bild. Während an den Gymnasien ein Viertel der Schüler den Kompetenzstufen 5 und 6 zugeordnet wird und fast alle Schüler die Basiskompetenzstufe II erreichen, gelingt dies 22,2 % der Schüler an den integrierten Gesamtschulen und fast 40 % der Hauptschüler nicht (Deutsches PISA-Konsortium, 2006, S. 6).
Aus den geringen geschlechterspezifischen Unterschieden der PISA-Studie 2006, insbesondere hinsichtlich der naturwissenschaftlichen Grundbildung, lassen sich keine Schlussfolgerungen für Risikolerner ziehen (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007a, S. 27).
2.3.2.5 Dimensionen für Risikolerner nach PISA
Die Hauptschule und ihre Schüler per se als Risikogruppe einzustufen, wäre angesichts der Ergebnisse der PISA-Studien wahrscheinlich nicht korrekt. Sicherlich treffen in der Hauptschule und in den integrierten Gesamtschulen ungünstige Verhältnisse aufeinander. Aber es ist angebracht, die Probleme der Schüler mit Migrationshintergrund gesondert zu betrachten, da bei ihnen die Frage nach der Sprache, die zu Hause gesprochen wird, für ihre schulischen Leistungen entscheidend zu sein scheint. Die Lesekompetenz der Jungen und damit deren Lese- bzw. Mediensozialisation ist dagegen ein wesentlicher Kern der Frage nach den Risikolernern, vor allem dann, wenn es um Jungen mit Migrationshintergrund geht (Bachmair, 2007c). Aber auch die Beispiele zu den unterschiedlichen Präferenzen bezüglich des Lesestoffs weisen auf mögliche Aneignungsstrategien der Jungen hin, die sich völlig von denen der Mädchen unterscheiden und in den PISA-Studien nicht hinterfragt wurden.
Ein weiterer Kern der Frage nach den Risikolernern in den PISA-Studien ist der auffällig enge Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status der Eltern (und schließlich auch der Schüler) und den Schulleistungen, die die PISA-Studien getestet haben. Dies ist so deutlich hervorzuheben, da die PISA-Studie 2003 offenbarte, dass die Hauptschüler im Bereich Problemlösen ungenutzte oder in den Schulfächern unentdeckte Potenziale haben.
Ein Forschungsdesiderat wäre an dieser Stelle die genaue Untersuchung der Stärken der Risikolerner anhand des Datenmaterials der PISA-Studien, um mögliche weitere unentdeckte Dimensionen und Potenziale der Schüler offenzulegen.
Die Ergebnisse der PISA-Studien in Bezug auf Risikolerner legen daher nahe, nach Mustern der Medienaneignung der Jungen zu suchen. Dabei scheint es notwendig, die Dimensionen des sozioökonomischen Hintergrunds zu beachten und die Schulform Hauptschule bzw. das Erreichen des qualifizierten Hauptschulabschlusses ebenso zu berücksichtigen.
2.4 Spezifische Risiken jugendlicher Jungen in der Perspektive männlicher Sozialisation
Die besorgniserregenden Ergebnisse der PISA-Studien vom Jahr 2000 bis 2006 haben die Jungen als eine der zentralen Risikogruppen in Bezug auf Lesekompetenz herausgestellt (siehe Kapitel ). Dieses Ergebnis legt für die Identifikation von Risikolernern nahe, die Jungen und ihre Muster der Medienaneignung, insbesondere der Aneignung mobiler Technologien, genauer zu betrachten. Eine solche genderspezifische Betrachtungsweise macht es unabdingbar, im Sinne eines theoretischen Rahmens die Bedingungen und funktionalen Zusammenhänge männlicher Sozialisation in diese Diskussion einzubeziehen. Dieser ‚kleine‘ theoretische Rahmen der Jungensozialisation ist dabei in den übergeordneten theoretischen Rahmen der Sozio-kulturellen Ökologie (siehe Kapitel Fehler: Referenz nicht gefunden) aus Struktur und kultureller Praxis eingeordnet, indem die Handlungskompetenz im Sinne eines männlichen Habitus als „Scharnier zwischen Körper und Gesellschaft, zwischen Handlung und Struktur“ (Martschukat & Stieglitz, 2008, S. 44) fungiert. Mit Blick auf die Zielgruppe der Risikolerner geht es speziell darum, besonders die Risiken männlicher Sozialisation aufzuzeigen. Eines dieser Risiken, die im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Jungen in den PISA-Studien stehen, ist es, in Familien aufzuwachsen, die zu weniger sozioökonomischen Ressourcen Zugang haben. Dementsprechend ist ein weiteres Risiko ein möglicher Migrationshintergrund. Der Besuch einer Hauptschule stellt zwar laut den PISA-Studien kein direktes Risiko dar, jedoch kommen an dieser Schulart laut den PISA-Studien Jugendliche aus genau solchen Risikomilieus zusammen, wodurch indirekt der Besuch der Hauptschule zum Risikofaktor wird.
Die Hauptfiguren der Theoriebildung im Bereich männlicher Sozialisation in Deutschland sind Lothar Böhnisch, Professor für Sozialpädagogik und Sozialisation an der TU Dresden, der für Jungensozialisation allgemein die „Entgrenzung der Männlichkeit“ (2004) propagierte und dabei die internationale Sichtweise von Robert W. Connell (vgl. bspw. 2005) in den Diskurs einbrachte. Böhnisch entwickelte daraus zusammen mit Reinhard Winter und Gunter Neubauer das „Balancemodell der Jungensozialisation“ (vgl. bspw. Reinhard Winter & Neubauer, 2001), das eine wesentliche Grundlage sozialer Arbeit außerhalb der Schule und in der offenen Jugendarbeit mit Jungen ist.
Daneben bringt Michael Meuser die Theorien von Pierre Bourdieu, Lothar Böhnisch und Klaus Hurrelmann mit dem Konzept des „Risikohandelns als Strukturübung“ zusammen (Meuser, 2005, 2006). Dieser Ansatz scheint zunächst sinnvoll, da Meuser den Begriff des Risikos als ständig begleitendes Merkmal männlicher Adoleszenz begreift. Dass dieses Risikoverhalten ein funktionaler Bestandteil Jugendlicher und vor allem männlicher Adoleszenz ist, argumentiert Jürgen Raithel (2005).
Der Erziehungswissenschaftler Jürgen Budde der Universität Hamburg beschreibt spezifische Risiken jugendlicher Jungen in der Schule (Budde & Faulstich-Wieland, 2005) und insbesondere am Gymnasium (Budde, 2005). Diese spezifischen Risiken der Jungensozialisation im Zusammenhang mit ihren Bildungsmisserfolgen beschreibt er auch für den bereits erwähnten einschneidenden und riskanten Moment des Übergangs in die Berufswelt (Budde, 2008).
Arne Niederbacher, Peter Zimmermann und Kollegen nutzen diese Ansätze als theoretische Grundlagen für ihre zweite Teilstudie „JUNGEN 2005 – Eine Bestandsaufnahme“, durchgeführt an der Professur für allgemeine Soziologie (Prof. Dr. Ronald Hitzler) der Universität Dortmund („JUNGEN 2005 – Eine Bestandsaufnahme“, o. J.; Koch-Priewe u. a., 2009) und liefern Ergebnisse und Interviews qualitativer Gruppendiskussionen.
Bevor die Kernaussagen und Ergebnisse für Risikolerner der Keyplayer männlicher Sozialisation paraphrasierend wiedergegeben werden, folgen einige eher populärwissenschaftliche Beschreibungen zu Jungen als Risikolerner.
2.4.1 Beschreibungen zu Jungen als Risikolerner
Erziehungsresistente Jungen
Der Jugendforscher Dirk Villányi von der Universität Bielefeld und Matthias D. Witte, Soziologe der Universität Rostock, skizzieren anhand der männlichen Figur Andreas B. problematische Jugendliche aus historischer Sicht (2006). Die Wahl einer männlichen Figur geschah sicher nicht ganz zufällig und die Verbindung mit dem Titel des Sammelbandes „Erziehungsresistent“ könnte bedeuten, dass es eher die Jungen sind, die erziehungsresistent sind – und dies in einer historischen Perspektive. Der Titel des Buches ist deshalb sicher auch provokativ zu verstehen, denn in der Einleitung geben die Autoren zu verstehen, dass sie explizit die sogenannten Problemjugendlichen meinen, die permanent ordnungsstörend sind. Da bei ihnen vielfach alle Formen der professionellen Hilfe versagen, nennt Matthias Schwabe sie „maßnahme-resistent“ (Schwabe, 2001). Dennoch ist dieser Begriff sehr problematisch und mit Vorsicht zu gebrauchen. Die Liste der Suchergebnisse mit dem Begriff „erziehungsresistent“, die Google am 19. Februar 2007 ausgab, lieferte dabei zwei große Diskurse. Viele Treffer verwiesen auf den im Jahr 2006 erschienenen Sammelband von Witte und Sander mit dem darin enthaltenen Aufsatz zur Figur des Andreas B. In diesem Fall ist das ein Verweis auf einen pädagogisch wissenschaftlichen Begriff, den laut der Trefferliste einige wenige pädagogische Fortbildungs-Websites aufgriffen. Der andere große Diskurs, den die Trefferliste aufdeckt, ist Hundeerziehung. In der Hundeausbildung bzw. -dressur taucht immer wieder die Frage bzw. die Erkenntnis auf, dass Hunde mehr oder weniger erziehungsresistent sind.
Gefährdungsgeneigte Jungen
Der Richtlinienkatalog der Kommission Jugendmedienschutz (KJM) geht unter dem Punkt „Entwicklungsbeeinträchtigung“ von einer Gruppe Jugendlicher aus, die gefährdeter sind als durchschnittliche Jugendliche, die schwächer und noch nicht in gleicher Weise entwickelt sind wie vergleichbare Altersgenossen. „Bereits gefährdungsgeneigte Jugendliche“ sollen die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) und die Freiwillige Selbstkontrolle Kino (FSK) bei der Begutachtung von Medienangeboten vor Augen haben und „angemessen berücksichtigen“ (Redaktionsgruppe der Landeszentrale für Medien und Kommunikation, 2005). Diese Gefährdungsneigung dreht Friedhelm Eller in seinem Gutachten für die Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (BAJ) in den Begriff der Vulnerabilität, also der Verletzlichkeit der Jugendlichen um. Er geht davon aus, dass Jugendliche häufig ihre Verletzlichkeit verneinen, was „Risikoverhaltensweisen begünstigt, zu denen m.E. auch die exzessive Befassung mit gewalthaltigen Medien zu zählen ist“ (Eller, 2000, S. 22). Er sieht Jugendliche als gefährdungsgeneigt, „deren Lebenssituation multiple Belastungen im Sinne entwicklungsrelevanter Risikofaktoren aufweist“ (ebenda, S. 21f). Dies ist auch der Grundgedanke des Jugendmedienschutzes, der von der Verletzlichkeit von Kindern und Jugendlichen ausgeht und prüft, ob bestimmte Medienangebote entwicklungsbeeinträchtigend sind, indem die Medienangebote in diese Verletzlichkeit beeinträchtigend eingreifen.
Medienverwahrloste Jungen
Der ehemalige Justizminister und Leiter des Kriminologischen Instituts Niedersachsen e. V. Christian Pfeiffer beschreibt, dass Jungen, da sie häufiger und länger fernsehen, indizierte Videofilme sehen und Computerspiele spielen, die erst ab 18 Jahren freigegeben sind, in einen Zustand der Medienverwahrlosung (Pfeiffer, 2003; Pfeiffer, Mößle, Rehbein, & Kleimann, 2007) geraten sind. Mit Medienverwahrlosung meint Pfeiffer, dass durch den zeitlich hohen Konsum unterschiedlicher Medien vor allem die Jungen keine Zeit mehr haben, z. B. in der Fußballmannschaft zu trainieren oder ein Musikinstrument zu üben. Die Jungen versäumten, so Pfeiffer, das Leben und könnten ihre soziale Kompetenz nicht voll entwickeln. Die durchaus fragwürdigen Rückschlüsse (vgl. Kübler, 2004), die Pfeiffer aus den Mediennutzungsdaten zieht, bestätigen in diesem Zusammenhang, dass die Beziehung zwischen Jungen und Medien ein Bestandteil des Risikos ihres Lebensabschnitts Jugend ist.
Zusammenfassung: Risikohandeln als Teil von Jungenkultur
Die beschriebenen Diskurse machen deutlich, wie nötig es ist, Jungen im Jugendalter und ihre Mediennutzung, insbesondere ihre Handynutzung, zum Forschungsgegenstand zu machen. Der Fokus liegt dabei auf den Risiken, die diesen Lebensabschnitt ausmachen. Aus dieser Gemengelage entstehen zur Zeit riskante, prekäre Jungenkulturen. Es gilt also, diese riskante und prekäre Lebenswelt der Jungen genau zu beschreiben und theoretisch einzuordnen.
Jugendliche Jungen wachsen in der Perspektive auf, die Gefährdeten zu sein, diejenigen zu sein, die bei PISA durchgefallen sind und in naher Zukunft wenig Aussicht auf einen Job zu haben. Jugendliche Jungen wachsen in Spannungsverhältnissen auf, müssen mit großen Ambivalenzen zurechtkommen und mit einer ungewissen Zukunft planen können bzw. mit der Ungewissheit der Zukunft umgehen.
2.4.2 Inhärente Risiken der Sozialisation jugendlicher Jungen
Das sich aus den vorhergehenden Kapiteln ergebende Bild von bzw. die Annahmen über Jungen im Jugendalter lassen die Vermutung zu, dass das Jugendalter für Jungen ein riskanter Lebensabschnitt ist. In diesem Lebensabschnitt werden Jungen häufig mit Begriffen wie „prekär“, „riskant konsumierend“, „bildungsarm“ oder „bildungsfern“, „erziehungsresistent“, „gefährdungsgeneigt“ oder „medienverwahrlost“ beschrieben (siehe Kapitel ). Diese Konzepte von Jungen sollen aber nicht bedeuten, dass Jungen grundsätzlich gefährlich und gefährdet sind und dass daraus direkt und unmittelbar ein Erziehungsbedarf und Entwicklungspotenzial bzw. ein grundsätzliches Defizit gegenüber Mädchen erwächst. Benno Hafeneger skizziert in einer deskriptiven und eher explorativen Weise zehn generalisierte und eher idealtypische Jungenbilder (Hafeneger, 2005):
-
Der starke, harte, kämpferische Junge:
-
Erwerbs- und Macht-Mann, Arbeiten bis zum Umfallen,
-
Ernährer und Familienoberhaupt – traditionelles und dichotomes Verständnis männlicher und weiblicher Geschlechterrollen,
-
martialisches Auftreten, Gewalt, Tätowierung, Kraft, Kampf, Zurichtung des Körpers.
-
-
Der abweichende, gefährliche und gefährdete Junge:
-
auffällig, schwierig und gefährlich (weil unreif) gegenüber sich selbst und der Gesellschaft,
-
Abweichungs- und Verwahrlosungsdiskurs.
-
-
Der zukunftsoffene, vitale, selbstbestimmte Junge:
-
Projektionsfläche einer besseren ’neuen Zukunft‘,
-
gegenkulturelle, alternative Aufbrüche und proklamierte Erneuerungen,
-
vielfach begleitet und in Obhut von zugeneigten Erwachsenen und der idealisierenden Aufwertung der Jugendphase.
-
-
Der angepasste, normale, nüchterne Junge:
-
lernt und arbeitet, ist konformistisch, er fällt nicht auf, ist ’normal‘, ‚lieb‘ und ’natürlich‘,
-
ist aktiv in den gesellschaftlichen Institutionen wie Sport und sonstigen Vereinen und Verbänden eingebunden,
-
in spezifischen Freizeit- und Kulturarrangements über die Stränge schlagen, z. B. durch Rausch-Rituale und Mutproben bei Gelegenheiten wie Kirmes, Karneval, Festen und Feiern.
-
-
Der gesunde, schöne, fitte Junge:
-
an die Marktwerte, Verkaufswerte und Konsumkultur gebundenes Jungenbild, das auf Körperlichkeit, Erotik, Gesundheit und Attraktivität setzt,
-
verlangt nach einer Bühne, nach Echo und Spiegelung,
-
körperlicher Habitus und modellierte, inszenierte und ‚geschmückte‘ Oberfläche.
-
-
Der individualisierte Junge:
-
instrumentell-kalkulierend, mutig, stark, selbstbewusst und durchsetzungsfähig,
-
mobil und flexibel für seinen zukünftigen materiellen Erfolg und seine beruflich-soziale Platzierung,
-
Zukunft wird individualisiert und als Herausforderung an die Jungen selbst weitergegeben.
-
-
Der coole, souveräne, witzige Junge:
-
der Junge, der alles kontrolliert und im Griff hat, der mit sich, seinem Körper und seiner Umwelt cool und lässig, souverän und witzig, auch ironisierend umzugehen weiß
-
selbstorientierte Sprache und Körperlichkeit sowie Genuss und Erfolg.
-
-
Der abgehängte, vernachlässigte, diskriminierte Junge:
-
prekäre Lage der neuen Verlierer des Bildungssystems,
-
empirisch gestütztes Verlierer- und Opferbild,
-
Haupt- und Sonderschüler und vor allem männliche Jugendliche mit Migrationshintergrund.
-
-
Der engagierte, gebildete und gute Junge:
-
der Mittelschicht zugewiesen,
-
Mischung aus Bildung, Leistungsbereitschaft und Engagement („caring“),
-
weiß um die Balance zwischen verschiedenen Anforderungen, sieht die Bedeutung von Fürsorglichkeit, der Übernahme von sozialer, auch häuslicher Verantwortung.
-
-
Der neue, reflexive, gebastelte Junge:
-
gesprächsbereite, reflexive Form der Selbstvergewisserung im Spiegel der anderen,
-
das Zulassen von Fremdheit,
-
Mischung von „mal stark, mutig“ und „mal traurig, unterlegen“, „mal aktiv“ und „mal passiv“, auch mal „ängstlich und schwach“ sein oder spielerisch und vorübergehend Elemente und Kombinationen ausprobieren (vgl. ebenda, S. 8-13).
-
„Empirisch kommen die Bilder kaum so eindeutig und klar vor, mit allen Brüchen und Widersprüchen überschneiden sie sich, existieren sie historisch in unterschiedlichen Relationen deutlich, abgeschwächt und nebeneinander“ (ebenda, S. 7). Dies bedeutet, dass in allen zehn Jungenbildern viel Potenzial für Risiken und Brüche steckt. Das Jugendalter scheint für Jungen generell eine mehr oder weniger riskante Zeit zu sein, und die genannten Begriffe dienen dazu, das Risiko, das die Sozialisation der Jungen auszeichnet, zu beschreiben. Diese von Hafeneger nicht detaillierter ausgeführten und belegten Jungenbilder dienen zum einen als Illustration aktueller Annahmen über das, was Jungensozialisation ausmacht, und zum anderen verdeutlichen sie, dass es sehr wohl mit dem Bild des „abgehängten, vernachlässigten, diskriminierten Jungen“ und dem „abweichenden, gefährlichen und gefährdeten Jungen“ konkrete Bilder männlicher Risikolerner gibt. Inhärente Spannungen, Risiken, Brüche und Widersprüche kann man aber auch in den anderen Jungenbildern erkennen. Diese Jungenbilder können die folgenden theoretischen Grundüberlegungen zu Männlichkeit in der Gesellschaft deutlicher erklären.
2.4.2.1 Hegemoniale, multioptionale, entgrenzte Männlichkeiten in der Gesellschaft
Der auf internationaler Ebene bedeutende Sozialisationsforscher Robert Connell geht in Bezug auf Männlichkeit davon aus, dass Geschlechterverhältnisse in aktuellen Industriegesellschaften in drei Dimensionen eingelassen sind:
-
In den jeweils herrschenden politischen Machtkonstellationen,
-
in der Hierarchie der Arbeitsbeziehungen,
-
in den emotionalen Beziehungsverhältnissen (Connell, zitiert nach: Böhnisch, 2004, S. 33).
„Diese sind gleichzeitig durch Klasse und Rasse sozial differenziert und hierarchisiert, sodass das Geschlecht nicht für sich gesehen werden kann, sondern an die jeweiligen sozialstrukturellen Verhältnisse gebunden ist.“ (ebenda)
In den historischen Veränderungsdynamiken auch innerhalb dieser drei Dimensionen hat sich Männlichkeit ebenso entwickelt und verändert, „vom starren System patriarchaler Gewalt hin zum elastischen indirekten Dominanzkontext hegemonialer Männlichkeit“ (ebenda). Diese hegemoniale Männlichkeit meint, dass es „eine jeweils bestimmte Gruppe dominanter und einflussreicher Männer“ gibt, „die diesen hegemonialen Typ Männlichkeit verkörpern“ und dabei „der Masse der Männer als identitätsstiftendes Orientierungsmuster dien[en], obwohl sie real über diese Dominanz gar nicht verfügen können“ (ebenda). Dabei ist der Begriff der Hegemonie sowohl auf die Gesamtheit der Männer im Unterschied zu Frauen zu beziehen als auch auf Differenzierungen und Konkurrenz innerhalb der Gruppe der Männer selbst (Koch-Priewe u. a., 2009, S. 17). Indem sich Lothar Böhnisch auf Robert Connell bezieht, macht er klar, dass es für Männer eine Option unter mehreren ist, auf männliche Hegemonie zurückzugreifen und sich z. B. manifester und struktureller Gewaltformen zu bedienen (Böhnisch, 2004, S. 34). Diese männliche Gewalt bzw. Hegemonialität verweist auf „Strukturen sozialer Ungleichheit“ und ist „Zeichen von Ungleichgewichten und Krisen in der männlichen Dominanzkultur“ (ebenda). Böhnischs Kritik am Konzept Connells setzt an der Betonung der „Dominanz von Männlichkeit“ an, da es „die Seite der männlichen Verfügbarkeit“ (ebenda, S. 35) zu verdecken droht.
Michael Meuser macht dabei klar, dass diese neue Multioptionalität (Meuser, 2006, S. 136), zwischen Männerbildern auszuwählen, gravierende Auswirkungen auf die Konstruktion von Ehe und Familie hat. Noch schärfer drückt es Ulrich Beck aus: „Mit fortschreitender Modernisierung vermehren sich in allen gesellschaftlichen Handlungsfeldern die Entscheidungen und Entscheidungszwänge“ (Beck, 1986, S. 190). Diese Entscheidungsmöglichkeiten oder Optionen muss man aber als sehr breites Feld verstehen, auf dem in fließender und zeitlich instabiler Weise alles verhandelbar ist, dazu gehören Selbstkonzepte wie die von Hafeneger beschriebenen Jungenbilder bis hin zu Fragen bezüglich einer Lebensgemeinschaft, beispielsweise: „wer wann den Abwasch macht, die Schreihälse wickelt, den Einkauf besorgt und den Staubsauger herumschiebt“, „wer die Brötchen verdient, die Mobilität bestimmt, und warum eigentlich die schönen Nachtseiten des Bettes immer mit dem qua Standesamt hierfür vorgesehenen, angetrauten Alltagsgegenüber genossen werden sollen dürfen“ (ebenda). Für den Begriff der Risikolerner ist an dieser Stelle entscheidend, dass je mehr und je öfter Entscheidungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen bzw. Entscheidungszwänge zu bewältigen sind, umso häufiger Risiken entstehen, sich falsch zu entscheiden.
Aus der Argumentationslinie der von Beck thematisierten fortschreitenden Modernisierung und Enttraditionalisierung und des damit einhergehenden Verschwindens des Normalarbeitsverhältnisses entwickelt Lothar Böhnisch das Konzept der Entgrenzung der Männlichkeit (Böhnisch, 2003b, S. 43, 2004, S. 45). Das Normalarbeitsverhältnis ist gekennzeichnet durch einen „lebenslang gültige[n] Beruf, tarifliche und soziale Absicherung, Vollzeitarbeit“ (Böhnisch, 2004, S. 44), jedoch macht es den „ökonomisch-gesellschaftlichen Kern der Definition von Männlichkeit im sozialstaatlich regulierten Kapitalismus aus“ (ebenda). Die Erosion und Transformation des Normalarbeitsverhältnisses vollzieht sich in Richtung prekärer Beschäftigungsverhältnisse, flexibilisierter Arbeit aus Leiharbeit, befristeter Beschäftigung, ICH-AGs, Minijobs, Teilzeitarbeit usw., wovon nicht nur Geringqualifizierte betroffen sind (Brinkmann, Dörre, & Röbenack, 2006), sondern auch die digitale Bohème aus gut ausgebildeten, oft studierten, motivierten jungen Menschen, insbesondere Männern. Nun sind aber diese Tendenzen der Prekarisierung für die Männer besonders gravierend, da sich die Männer der Modernisierung und der Multioptionalität gegenüber eher sperren und im Laufe der letzten Jahrzehnte „Widerstände gegen eine Auflösung von Sicherheiten pflegten“, wohingegen sich die Frauen zu den Protagonistinnen des Modernisierungsschubs erklärten (Meuser, 2006, S. 136f).
„Die Übereinkunft zwischen den Geschlechtern darüber, wie der Aufbau der Familie und die Erziehung der Kinder realisiert werden soll, bleibt ihnen privat überlassen. Gleichzeitig aber liegt diese Aushandlung nicht in ihrer freien Verfügung: Die Intensivierung der Arbeit und die ‚von Natur aus‘ höhere industrielle Verfügbarkeit des Mannes wirken meist in der Richtung, dass sich in den Familien die herkömmliche Rollenaufteilung der Geschlechter als resistent erweist bzw. immer wieder neu ausgehandelt wird und zwar restitutiver als dies die Entwicklung der Geschlechtergleichstellung in der Sphäre der sozialstaatlichen Regulation vermuten ließe. Viele Männer möchten gerne die sozialstaatlich gedeckten Ansprüche auf Teilhabe in Familie und an der Erziehung realisieren, werden aber durch intensivierte ökonomische Einbindung und Vernutzung daran gehindert.“ (Böhnisch, 2004, S. 44)
So gerne sich die Männer dieser Entscheidung entziehen würden und am männlich hegemonialen Normalarbeitsverhältnis festhalten würden, ist doch die Option der Nichtentscheidung tendenziell unmöglich (Beck, 1986, S. 190). Ulrich Beck führt hier das Beispiel an, zwischen der Mobilität zum Arbeitsplatz und der häuslichen Nähe zur Familie entscheiden zu müssen und gleichzeitig dem Arbeitsmarkt bedingungslos zur Verfügung zu stehen. Kritisch wird es aber, wenn „beide Ehepartner frei für lohnarbeitsabhängige Existenzsicherung sein müssen oder wollen“ (ebenda, S. 191), denn an dieser Stelle wird nicht nur das Konzept der Paarbeziehung infrage gestellt, sondern das Kind wird „zur letzten verbliebenen, unaufkündbaren, unaustauschbaren Primärbeziehung“ (ebenda, S. 193).
„Die ökonomisch-technologische Welt“ ist als eine männliche Welt zu verstehen, „zumal der Mann ihr unbegrenzt verfügbar, weil nicht weiblich-reproduktiv gebunden ist“ (Böhnisch, 2004, S. 38). Lothar Böhnisch sieht an dieser Stelle Familie als sehr viel brüchiger an, als es Ulrich Beck macht. Männer können eben nicht in aller Konsequenz genau diese unaufkündbare letzte Beziehung zum Kind eingehen. Diese ultimative Wahlentscheidung – einerseits für ein Kind und andererseits für die klassische Kleinfamilie als Lebensform, die für Stabilität und Normalität steht – können nur noch Frauen allein treffen. Daher sind dann die Männer in dieser Beziehungskonstellation trotzdem wieder allein verpflichtet, die Familie zu ernähren und sich der „ökonomischen Vernutzung“(vgl. ebenda, S. 44) und den prekären Arbeitsverhältnissen preiszugeben.
In diesem Spannungsverhältnis aus prospektiven prekären Arbeitsverhältnissen, fast unendlichen und riskanten Wahlverpflichtungen, die auch die Frage nach dem Bild über sich selbst einschließen, wachsen Jungen heutzutage auf und müssen diese gesellschaftlichen Kontexte produktiv verarbeiten. Für Risikolerner ist dabei die Aussicht auf eben diese – auch für Männlichkeit – sicheren Normalarbeitsverhältnisse aufgrund ihrer geringen Qualifikation eher schlecht. Damit geht einher, dass sie dann aber auch für das Versorgen einer Familie eine schlechte Ausgangsposition haben, worin wiederum soziale Ungleichheiten und deren zukünftige Reproduktion zutage treten.
2.4.2.2 Risiken der Jungen in der Schule
Als einer der Keyplayer zum Thema Jungensozialisation in der Schule widmet sich der Hamburger Erziehungswissenschaftler Jürgen Budde der Frage, „welche Möglichkeiten zur Konstruktion von Männlichkeiten das Feld Schule den Schülern bietet“ (Budde, 2005; Budde & Faulstich-Wieland, 2005, S. 37). Als Ausgangsposition führt Budde das hochgradig ambivalente Bild der Jungen in der Schule an, von dem Teile bereits erwähnt wurden:
-
Mehr Jungen als Mädchen machen einen Hauptschulabschluss bzw. gehen ohne Abschluss von der Schule und besitzen damit eine vergleichsweise niedrigere Qualifikation.
-
Im Fach Deutsch werden die Leistungen der Jungen mit zunehmendem Alter schlechter.
-
„Jungen orientieren sich in ihren Berufswünschen sowie den Ausbildungswegen an tradierten Geschlechterbildern und ergreifen Berufe im handwerklichen und industriellen Bereich. Dies kann sich aufgrund des Wandels zur wissensbasierten Dienstleistungsgesellschaft zunehmend als riskante Strategie erweisen.“
-
„Vergleicht man in unterschiedlichen Fächern die Leistungen bei gleichem Interesse, zeigen sich nur geringe Kompetenzdifferenzen.“
-
Der Leistungsvorsprung im Fach Mathematik wird mit zunehmendem Alter größer gegenüber den Mädchen.
-
In der beruflichen Laufbahn schneiden junge Männer häufig erfolgreicher ab. Sie ergreifen meist besser bezahlte und karriereorientiertere Berufe. (vgl. Budde, 2008, S. 5)
Das Bild der Jungen an der Schule ist geprägt von Ambivalenzen – s ind Jungen doch laut, stören den Unterricht, sind rüpelhaft und machen Probleme. Nach der PISA-Studie 2000 war dann auch belegt, dass Jungen zu alldem schlechtere Leseleistungen haben, geringer qualifiziert sind und möglicherweise „insbesondere von Grundschullehrerinnen benachteiligt werden“, und letztlich durch ihren geschlechtlichen Status als Jungen per se auffallen (Budde & Faulstich-Wieland, 2005, S. 37). Doch diese Problematisierung neigt dazu, ein Bild der Jungen zu verdecken, in dem sie mindestens ebenso erfolgreich sind wie Mädchen, z. B. im Fremdsprachenunterricht, in Mathematik und naturwissenschaftlichen Fächern (Budde, 2008). Gleichzeitig hat aber dieser Erfolg bereits Brüche, da auch in den unteren Kompetenzbereichen in Mathematik, Informatik und in den naturwissenschaftlichen Fächern wiederum mehr Jungen als Mädchen sind (ebenda), was Jürgen Budde auf eine „Tendenz zur Selbstüberschätzung“ zurückführt (ebenda, S. 22). Er fügt dem hinzu, dass auch Lehrer und Lehrerinnen die Leistungen der Jungen als grundsätzlich höher einschätzen würden, da diese Fächer als Jungendomänen gelten. Diese Einschätzung führt dann zwangsläufig zu einem höheren Leistungsdruck auf die Jungen, den viele von ihnen nicht erfüllen können.
Statushandlungen und die soziale Konstruktion von Männlichkeit in der Schule
Männlichkeit ist auch in der Schule ein sozial konstruierter und situativer Bereich von Geschlechtlichkeit. So werden auch in der Schule gesellschaftliche Strukturen mit dichotomen und auf Eindeutigkeit angelegten geschlechtlichen Symboliken verbunden (Budde & Faulstich-Wieland, 2005, S. 38).
„Die soziale Welt konstruiert den Körper als geschlechtlicheTatsache und als Depositorium von vergeschlechtlichtenInterpretations- und Einteilungsprinzipien.“ (Bourdieu & Bolder, 2005, S. 22)
„Die gesellschaftliche Definition der Geschlechtsorgane ist also keineswegs ein bloßes Verzeichnen natürlicher, unmittelbar für die Wahrnehmung vorhandener Eigenschaften. Sie ist vielmehr das Produkt einer Konstruktion, die um den Preis einer Reihe von interessengeleiteten Entscheidungen oder, besser, Hervorhebungen bestimmter Unterschiede und Unterschlagungen bestimmter Ähnlichkeiten durchgeführtwird.“ (ebenda, S. 29)
Aus dieser Perspektive des männlichen Habitus, der sozial und interaktiv konstruierten Männlichkeit, die auf Eindeutigkeit ausgelegt ist, und aus den vier Handlungsmustern hegemonialer Männlichkeit von Robert Connell (2006, S. 97ff) arbeitet Jürgen Budde ein Set typischer Statushandlungen der Jungen in der Schule heraus. Die vier von Connell vorgeschlagenen Handlungsmuster oder, mit Verweis auf Hafeneger, Jungenbilder sind die hegemoniale, die komplizenhafte, die untergeordnete und die marginalisierte Männlichkeit. Budde selbst fügt dem noch die alternative Männlichkeit hinzu (Budde, 2005, S. 240). Im Kern bedeuten diese, dass die hegemoniale Männlichkeit als primär vorherrschende, auf Dominanz ausgerichtete Männlichkeit von der Komplizenschaft des „gewöhnlichen Jungen“ (Budde, 2005, S. 237) unterstützt wird. Die untergeordnete Männlichkeit dient dabei durch symbolischen Widerstand als Opfer, reagiert auf Entwertungen und passt sich an (ebenda, S. 238), während die marginalisierte Männlichkeit „durch die Androhung oder den Vollzug symbolischer Verweiblichung exponiert und damit aus dem Kreis der legitimierten Männlichkeiten verstoßen“ wird (ebenda, S. 239f). Budde betont dabei, dass diese Jungenbilder nicht personenspezifisch oder zeitlich stabil sein müssen. Die Jungen changieren zwischen diesen Bildern und Handlungsmustern (ebenda). Diesem System hegemonialer Männlichkeiten liegt die Annahme zugrunde, dass Geschlechter dichotom und hierarchisch auf Heterosexualität ausgerichtet sind (Budde & Faulstich-Wieland, 2005, S. 39). Markant ist hierfür, dass es neben der eindeutigen, heterosexuellen Männlichkeit nur Weiblichkeit geben kann und eben dann alles, was nicht eindeutig als männlich identifizierbar ist, nur noch weiblich sein kann (ebenda).
Die vier erwähnten „Statushandlungen als Konstruktion von Männlichkeit in der Schule“ (ebenda, S. 41) kann man als Handlungsmuster der Jungen in der Schule wie folgt zusammenfassen:
-
Konkurrenz und Kumpanei:
Mit den Mechanismen der Inklusion zu und Exklusion aus geschlechterhomogenen Gruppen stützen und bestätigen Jungen ihre Männlichkeit. Hierzu passen wahrscheinlich die homogene und komplizenhafte Männlichkeit gegenüber der unterlegenen Männlichkeit.
-
Symbolische Verweiblichung und Entwertung:
Ebenso wie das vorhergehende Muster zielen Mechanismen der symbolischen Verweiblichung darauf ab, eine Gruppe des „Wir“ in der Abgrenzung zu anderen herzustellen. Es geht darum, Männlichkeiten zu stigmatisieren, zu entwerten und als weiblich zu kennzeichnen, die als abweichend von der hegemonialen und als symbolisch einheitlich angenommenen Männlichkeit gelten. Hierzu gehören auch Homosexualitätszuschreibungen innerhalb von Jungengruppen. In diesem Zusammenhang berichten Koch-Priewe u. a., dass Jungen, selbst zu ihrem besten Freund, immer eine gewisse räumliche Distanz zu wahren versuchen, um auf keinen Fall den Verdacht zu erwecken, homosexuell zu sein (2009, S. 73).
-
Sexualisierungen:
Sexualisierungen dienen, so die Autoren, weniger der Statusdefinition innerhalb der Jungengruppe, sondern primär der symbolischen Verdeutlichung und Durchsetzung hegemonialer, heterosexueller Männlichkeit (Budde & Faulstich-Wieland, 2005, S. 46).
-
Transformationen:
Unter der Überschrift „Transformation“ führen die Autoren Handlungsmuster der Jungen an, die auf Veränderungen am Grundsatz der hegemonialen Männlichkeit hinweisen. So spielt körperliche Gewalt durch Jungen nur eine sehr untergeordnete Rolle (ebenda, S. 48) und man hat eher Gewalt durch Mädchen gegen Jungen beobachtet. Hinzu kommen situative Durchkreuzungen der Dichotomie der Geschlechterordnung mittels spaßhafter Irritationen (ebenda) und „die häufige Verwendung ursprünglich feministischen Vokabulars durch die Schüler“. So haben sie in selbstreflexiver und bewusster Weise „Männerpower“ eingefordert „oder auf tatsächliche Benachteiligungen im schulischen Alltag“ hingewiesen (ebenda). Diese von der Forschergruppe beobachteten Transformationen kann man gleichzeitig als Kritik an der möglicherweise nicht mehr zeitgemäßen Theorie der hegemonialen Männlichkeit sehen. Die Autoren geben zu bedenken, dass das System hegemonialer Männlichkeit keine Selbstverständlichkeit mehr ist und ständiger Aushandlung bedarf. Die Gruppe der Jungen handelt innerhalb des sozialen Raums Schule Männlichkeiten zusammen mit den Mädchen aus (ebenda, S. 79).
Benachteiligung der Jungen durch die Schule
Die Statushandlungen der Jungen in der Schule lassen die Frage unbearbeitet, ob möglicherweise das System Schule in Zusammenhang mit den widersprüchlichen Schulleistungen der Jungen steht und ob und inwiefern die Institution Schule und ihre LehrerInnen männliche Sozialisation mit prägen. So berichten Koch-Priewe u. a., dass die Debatte um Koedukation „zumeist aus der Perspektive der Mädchen diskutiert wird“ (2009, S. 19) und dass „durch den hohen Frauenanteil zumindest unter den Grundschullehrkräften die Jungen strukturell benachteiligt sind“ (ebenda, S. 22). Wobei die Autoren für beide genannten Punkte aufgrund der Ambivalenz der Ergebnisse keine eindeutigen Erklärungen anführen konnten. Eine deutlichere Erklärung scheint dagegen, dass diejenigen Jungen, die allzu hegemoniale Männlichkeiten als Handlungsmuster für sich verwenden, nicht mehr zur ‚Schule‘ passen (Koch-Priewe, 2005, S. 26). Ein „angepasstes, prosoziales Verhalten und Fleiß“, wie man es eher in der klassischen Mädchenrolle vermutet, passt besser in eine ‚Schule‘, die „angemessene Arbeitsdisziplin, ein breites fachliches Interesse und eine Bereitschaft, Lehrkräfte als Experten und Autoritäten anzuerkennen“, einfordert (Koch-Priewe u. a., 2009, S. 23). Schulversagen und schlechte Schulleistungen sind auch mit bestimmten, vermutlich hegemonialen Männlichkeitsbildern verbunden. Mit Bezug auf das Verschwinden des Normalarbeitsverhältnisses und die Modernisierung der letzten Jahrzehnte argumentiert Koch-Priewe, dass hegemoniale Männlichkeiten angesichts neuer Anforderungen an Männer „antiquiert, zwanghaft und lächerlich“ (2005, S. 27) wirken und in der Schule zum Scheitern vieler Jungen beitragen.
„Vor allem Jungen aus Familien mit niedrigem sozialen Status bzw. solche, die aus bildungsfernen Schichten stammen und einen Migrationshintergrund haben, laufen Gefahr, zu den Modernisierungsverlierern zu gehören“. (ebenda)
Selbst in der Perspektive benachteiligter Mädchen argumentierend – „[a]ngesichts der wachsenden Bedürfnisse von Frauen“ (ebenda) – macht die Autorin klar, dass Jungen aus bildungsfernen Schichten das „traditionellste, antiquierteste Rollenverständnis von Männern und Frauen haben“ (ebenda).
2.4.2.3 Risikoverhalten und Körperlichkeit
Risikohandeln als Strukturübung
In der Forschungsliteratur zur Jungensozialisation scheinen die zusammenhängenden Themenbereiche Körperlichkeit und Risikoverhalten für Risikolerner hohe Relevanz zu haben. Beim Thema Körperlichkeit geht es um die körperlich-geschlechtliche Entwicklung der Jungen, und in der Sozialisationsperspektive um das Verhältnis der Jungen zu sich und zu ihrem Körper. Damit hängt direkt das Thema der gesundheitlichen Risiken zusammen und meint, dass Risikoverhalten ein eher aktiv riskantes Verhalten gegenüber der eigenen körperlichen Gesundheit bzw. der eigenen Unversehrtheit und teilweise der der anderen ist, das bei Jugendlichen häufig zu beobachten ist. Um die Lebenswelt und Sozialisation der Risikolerner zu verstehen, scheint es daher nötig, auch diesen Aspekt als Teil der inhärenten Risiken zu beschreiben, ernst zu nehmen und in die Betrachtung einzubeziehen.
In dieser Perspektive betrachtet Michael Meuser (2005) Risikoverhalten als eine für Jungen lebensphasentypische Entwicklungsaufgabe und Strukturübung in ihrer Adoleszenz. Er beschreibt hier Risikohandeln, vor allem männlicher Jugendlicher, als ständig begleitendes Merkmal männlicher Adoleszenz. Sei es riskantes Autofahren, exzessiver Alkoholkonsum in Form des Rauschtrinkens oder Schlägereien. In dieser Weise berichtet Bernd Hontschik im gleichen Band (2005) von auffällig vielen männlichen Jugendlichen, die, wenn sie überhaupt ins Krankenhaus müssen, am Wochenende in den chirurgischen Ambulanzen nach Verkehrsunfällen eingeliefert werden. Meuser stellt heraus, dass es hauptsächlich riskante, sich selbst gefährdende Aktivitäten sind, die mit Kraft und Körperlichkeit zusammenhängen. Charakteristisch ist für dieses Risikohandeln, dass diese Praktiken meist nicht in der Abgeschiedenheit passieren, sondern in einem „kollektiven Rahmen“ (Meuser, 2005, S. 310), wie z. B. „Extremsportarten oder Alkoholkonsum als Gruppenritual“ (ebenda). Zentrales Prinzip dieses externalisierten Verhaltens in der Argumentationslinie hegemonialer Männlichkeit mit den Attributen Zähigkeit, Belastbarkeit, Tapferkeit und Härte (ebenda, S. 311) ist die als „Expansion“ betriebene Körperstrategie, im Unterschied zur „’Reduktion‘ als Merkmal weiblicher Körperstrategie“ (ebenda). Vor allem der Sport und dabei Sportarten mit verletzungsanfälligen Körperkontakten haben in der männlichen Sozialisation eine herausragende Funktion (ebenda). Meuser hebt für das Risikohandeln als Strukturübung hervor, dass das Sportliche den Übungscharakter oder das So-tun-als-Ob und das Kompetitive ausmacht, und beides ist explizit auf den eigenen Körper ausgerichtet. Dazu gehören auch die Massenschlägereien der Hooligans untereinander, die Battles der Breakdancer oder z. B. die absurd-riskanten Praktiken der Jackass-Darsteller auf MTV (ebenda, S. 320f).
Risikohandeln als konstitutiver Teil von Lebensstilen und Jungensozialisation
Der Sozialisationsforscher Jürgen Raithel befasst sich ebenfalls mit Risikohandeln als Teil von Jugendkultur und verbindet systematisch eigens generierte Lebensstile mit verschiedenen, kategorisierten Risikohandlungen. Diese Risikohandlungen umfassen die beiden Bereiche gesundheitsrelevantes und delinquentes Verhalten mit den Subkategorien
-
Substanzkonsum,
-
Ernährungsverhalten,
-
Straßenverkehrsverhalten,
-
Bewegungsverhalten/Sport,
-
Zahn-/Hygieneverhalten,
-
Sexualverhalten,
-
Sonnenschutzverhalten,
-
explizit risiko-konnotative Aktivitäten,
-
delinquentes Verhalten. (Raithel, 2005, S. 135)
Die Lebensstile generiert Raithel aus den Kategorien
-
Soziodemografie (Alter, Geschlecht, Schulbildung, Nationalität, Schulbildung und Berufsstatus beider Elternteile, Wohnstatus als Indikator für die finanzielle Lage),
-
Wertorientierungen,
-
Freizeitverhalten,
-
Kleidungsstil,
-
Musikkonsum,
-
Filmkonsum,
-
Zeitschriften und
-
Erziehungserfahrungen (ebenda).
Mit Relevanz für Risikolerner und Jungen hat Raithel zwei zentrale risikobezogene Lebensstilgruppen herausgearbeitet: die risikohaft-hedonistische Lebensstilgruppe und die risikobereit-bürgerlichkeitsablehnende Lebensstilgruppe (ebenda, S. 205). Allgemein für Jungen ist zudem der zurückhaltend-technikinteressierte Lebensstil relevant (ebenda, S. 164). Alle drei Lebensstile haben die Gemeinsamkeit des riskanten Ernährungsverhaltens. Für Jungen scheint hier die Völlerei (ebenda, S. 205) in Form von Fast Food und fleischreichen, hochkalorischen Nahrungsmitteln bedeutsam zu sein (ebenda, S. 164) – was zu dem von Meuser erwähnten Muster der Expansion passt –, wobei sie gleichzeitig „nährstoffbezogene hochwertige Ernährung“ ablehnen (ebenda, S. 204). Daneben nennt Raithel für die jungendominierten Lebensstile, dass sie durch „actionformatbezogenen Film- und Fernsehkonsum“ sowie durch „Risk-Fashion-Aktivitäten“ wie z. B. Risikosportarten auffallen (ebenda). Die Völlerei ist im Kontext von Männlichkeit verwandt mit einem Männlichkeitsbild im Sinne von „der kann aber viel trinken“ oder „der verträgt viel“. Wahrscheinlich ist das Bild des Viel-trinken-Könnens mit Phänomenen des Rauschtrinkens recht eng verwandt. Völlerei und Vieltrinken kann man eventuell eher mit Blick auf Formen harter körperlicher Arbeit erklären. Darin liegt dann ein Männlichkeitsbild, das einen muskulösen, körperlich hart arbeitenden Mann beschreibt, der möglicherweise im Wald oder auf dem Feld verhältnismäßig viel Kalorien verbrennt. Harte Arbeit macht hungrig, und ein kräftiges Essen sowie Bier bringen verbrannte Nährstoffe zurück. Dieses Männlichkeitsbild gibt es heutzutage als idealisiertes Bild immer noch, wobei Völlerei, Vieltrinken und harte körperliche Arbeit einander gegenseitig erklären: Völlerei verweist auf einen hart arbeitenden Mann und bedeutet ein positives Bild und umgekehrt. Nun sind aber die Formen harter körperlicher Arbeit, auch im Zuge der Transformation und Auflösung des Normalarbeitsverhältnisses, fast verschwunden. Erst durch diese Veränderung von Arbeit und damit Männlichkeit hat sich das Vielessen als Rückführung verlorener Nährstoffe zur Völlerei gewandelt. Erst ohne körperliche Arbeit und das Verbrennen großer Mengen an Nährstoffen wird die Völlerei zum Risikohandeln, das Übergewicht, Herzinfarktgefahr usw. mit sich bringt.
An den risikobezogenen Gruppen „risikohaft-hedonistische Lebensstilgruppe“ und „risikobereit-bürgerlichkeitsablehnende Lebensstilgruppe“ fällt gleichermaßen das „riskante Freizeit- und Verkehrsverhalten“, „delinquentes Verhalten“ und die Affinität zum Alkoholkonsum auf (ebenda, S. 206). Jungen dieser Gruppen trinken „vornehmlich Bier und harte Alkoholika“ (ebenda) und dies „entsprechend intensiv und regelmäßig“ (ebenda).
Den risikobereit-bürgerlichkeitsablehnenden Lebensstil zeichnet besonders die Abwendung „von bürgerlichen Wertvorstellungen als auch hochkulturellen Stilisierungsformen“ aus (ebenda, S. 167). Dies zeigt sich in der ablehnenden Haltung gegenüber den Stichworten Familie, Berufsorientierung, kulturelle Aktivitäten, qualitativ hochwertige Kleidung und vollwertige Nahrungsmittel. Die distinktive Ablehnungshaltung gegenüber der Mehrheitsgesellschaft macht es Raithel schwer, „ein deutliches und greifbares Bild dieser Lebensstilgruppe“ zu zeichnen (ebenda, S. 168). Die Gruppe setzt sich zu 84 % aus Jungen zusammen, wobei deren Eltern „ein leicht überdurchschnittlich niedriges und mittleres Bildungsniveau“ haben (ebenda, S. 169). Insgesamt macht diese Gruppe 11,7 % der von Raithel befragten Gruppe Jugendlicher aus.
Den risikohaft-hedonistischen Lebensstil zeichnet besonders die „hedonistische expressiv-ästhetische Lebensorientierung“ und die „Affinität zu und Ausübung von Risikoverhalten“ aus (ebenda, S. 169). Die wichtigsten Beschäftigungen in der Freizeit sind Ausgehen und Computer- sowie Internetnutzung. Sie bevorzugen Actionformate und grenzen sich aktiv gegen kulturelle Aktivitäten „wie Besuche von Theater oder klassischen Konzerten sowie […] Bücher lesen“ ab (ebenda, S. 170). Ihr Risikohandeln ist in allen Bereichen auffallend groß und reicht von Fast-Food-Ernährung und fleischreicher Ernährung, der Affinität zu risikobezogenen Aktivitäten und waghalsigen Unternehmungen, über leichte delinquente Verhaltensweisen wie Dealen (kleinerer Handel mit Betäubungsmitteln), Fahrraddiebstahl oder Sprayen von illegalen Graffitis und Tags, bis hin zu der Begehung schwerer Delikte wie Körperverletzung, Raub, Erpressung oder Sachbeschädigung, riskantem Verkehrsverhalten oder hohem Substanzkonsum von Tabak, Bier oder weiteren Alkoholika (ebenda, S. 171). Diese Gruppe Jugendlicher, die 8.4 % der gesamten Befragungsgruppe ausmacht, besteht zu 95.7 % fast nur aus Jungen, die zu 62.8 % einen Hauptschulabschluss haben. Auch deren Eltern haben zu fast 50 % einen Hauptschulabschluss (ebenda, S. 172). Auffallend an dieser Gruppe ist darüber hinaus, dass sie fünfmal so häufig wie andere Lebensstilgruppen über „erlebte und erlittene nonviolente wie körperlich verletzende Sanktionen“ (ebenda, S. 172) berichten. Raithel sieht hierin einen engen „Zusammenhang zwischen innerfamiliären Gewalterfahrungen und eigener Gewalttätigkeit“ (ebenda). Da auch keine andere Gruppe in diesem Ausmaß „eine inkonsistente (19 %) wie auch gleichgültige Erziehung (34 %) erlebt“ hat, schließt Raithel, dass sich in diesem Lebensstil „die negativen Erziehungserfahrungen zu einer sehr prekären Konstellation familiärer Sozialisation“ anhäufen (ebenda).
Jürgen Raithel ist es mit seiner Studie gelungen, die in den vorangegangenen Kapiteln erwähnten Bezugspunkte für Risikolerner in Lebensstilen der Jugendlichen zu beschreiben. Es ist daher möglich und legitim, zwischen Jungen, Hauptschule, einer Distanz zur Schule und weiteren auffälligen Merkmalen der Jungen, die nun als Risikohandeln begrifflich verfügbar wurden, einen deutlichen Zusammenhang zu formulieren. Dabei ist für Raithel die hegemoniale Männlichkeit kein forschungsleitendes Thema, wie es dies z. B. für Meuser, Budde oder Koch-Priewe ist. Raithel betont zwar, dass hegemoniale Männlichkeit nach wie vor ihre Gültigkeit hat, durch die Anlage seiner Studie und die Entwicklung der Lebensstile sind Gender-Modelle und Formen individueller Geschlechtskonstruktionen in diesem Konzept variabel und ambivalent (ebenda, S. 120).
2.4.2.4 Balancieren ambivalenter Männlichkeiten
Das vorläufige Fazit für Risikolerner und Jungensozialisation kann man gleichsam als Zustandsbeschreibung der Jungen in Deutschland und wahrscheinlich in Zentraleuropa allgemein sehen. Es geht konform mit dem Gesamtfazit der Studie „Jungen 2005 – Eine Bestandsaufnahme“ (Koch-Priewe u. a., 2009), in der „1635 Jungen aller Schulformen (inklusive der Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen) im Alter zwischen 14 und 16 Jahren“ (ebenda, S. 165) zu ihrem Freizeitverhalten, Vorbildern, Selbstwahrnehmung / Selbstbilder, Beziehungsgestaltung, Selbstwirksamkeitserwartungen, Einstellung zur Schule / Koedukation, Schulerfahrungen sowie zum sozialen und kulturellen Hintergrund, zu den Bildungsabschlüssen der Eltern und zur Schulformzugehörigkeit befragt wurden. Zu den wesentlichen Ergebnissen gehört, „dass die Lebensentwürfe von Jungen ausgesprochen vielfältig und ausdifferenziert sind“ (ebenda, S. 169). „Das dichotome Denken, welches im Alltag ausgesprochen plausibel erscheint, ist insgesamt fragwürdig geworden“ (ebenda). Dies markiert einen Unterschied zur ersten Studie von 1995, in der Jungensozialisation noch sehr davon geprägt war, dass sich Jungen an „traditionellen Mustern von Männlichkeit“ orientierten und ein möglicherweise überschätzendes, „ausgeprägt positives Selbstbild von sich“ hatten (ebenda, S. 184). Dabei befanden sie sich „qua Geschlecht in einer widersprüchlichen bzw. paradoxen Situation“ (ebenda): Man erwartete von ihnen „lässige, männliche Überlegenheit und selbstverständlich auch Durchsetzungsfähigkeit (als rigide, typisch männliche Rollenanforderungen)“, gleichzeitig sollten sie „neuen gesellschaftlichen Anforderungen“ genügen, die eigentlich weiblich konnotiert sind, „wie beispielsweise Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit oder Empathie“ (ebenda). Diese hochgradig ambivalente, verdeckende und riskante Erwartungshaltung an die Jungen hat sich mehr als eine Dekade später für eine Vielzahl der Jungen entschärft. So gelingt der Mehrzahl der Jungen das Balancieren zwischen Männlichkeiten. Die Autoren formulieren dies auch nicht in einer Erwartungshaltung an die Jungen. Jungen haben hingegen das Bild des smarten und coolen Gewinnertyps, „aber ohne Ecken und Kanten, d.h. gut aussehend, stark, intelligent und witzig“, selbst hervorgebracht (ebenda, S. 185). „Große Zustimmung findet aber auch ein Männertyp, der für Harmonie, Zuverlässigkeit und Sicherheit steht“ (ebenda). So sehr an dieser Stelle eine deutliche Veränderung in der Jungensozialisation erkennbar ist, gelingt dieses Balancieren (Reinhard Winter & Neubauer, 2001) und Erfüllen großer, ambivalenter Erwartungen nicht allen Jungen gleichermaßen gut. Aus den vorangegangenen Kapiteln wurde die Bedeutung der sozialen Lage, der Verfügbarkeit von Ressourcen für gelingende Sozialisation und Bildung erkennbar; dieser Aspekt wird auch weiterhin eine große Rolle spielen und Gegenstand dieser Untersuchung sein. Die Ergebnisse aus dem Zusammenhang Jungen und Medien folgen in Kapitel Fehler: Referenz nicht gefunden.
1 So liest man z. B. über Bestrebungen zu Gesetzesentwürfen, bestimmte Computerspiele zu verbieten oder das Internet für bestimmte Nutzungen zu sperren, mit der Annahme, dass bereits die Nutzung solcher Angebote zu Schädigungen der Persönlichkeit führt und nur ein Verbot dieser Angebote Menschen schützen könne. Siehe dazu z. B.: http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,631341,00.html [Abgerufen am 02.11.2012].
2 Mehr dazu unter: http://www.ewi.hu-berlin.de/wipaed/Forschung/abgeschlossene_projekte/MDQM/ [Abgerufen am 31.10.2012]
3 http://www.google.de/search?hl=de&q=Aufmerksamkeitsspanne&btnG=Suche&meta= [Abgerufen am 31.10.2012]
4 http://www.zweite-chance.eu/content/alte_foerderperiode_bis_3182008/literatur/index_ger.html [Abgefuren am 10.11.2009].
5 Siehe Daten unter http://www.education.gov.uk/rsgateway/DB/SFR/s000849/sfr12-2009.xls [Abgerufen am 31.10.2012]
6 https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/LangeReihen/Bevoelkerung/lrbev01.html [Abgerufen am 02.11.2012]
7 Eigene Auswertung nach https://www-genesis.destatis.de/genesis/online;jsessionid=D3D43C1C9F6B910D7D272074E7D8A30B.tcggen1?operation=abruftabelleAbrufen&levelindex=1&levelid=1263305151363&index=1 [Abgerufen am 02.11.2012]
8 Eigene Auswertung nach https://www-genesis.destatis.de/genesis/online;jsessionid=ECEB34A3F7B226A7FFED89D3BAB79B2D.tcggen1?operation=abruftabelleAbrufen&levelindex=1&levelid=1263313754426&index=3 [Abgerufen am 02.11.2012]